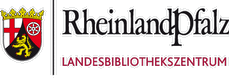Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung, 1362–1365, bearbeitet Hohensee von, Ulrike / Lawo, Matthias / Lindner, Michael / Rader, Olaf B. (= Monumenta Germaniae Historica: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum XIV). 2 Teilbde., Harrassowitz, Wiesbaden 2020 u. 2021. 4 o, LIV, 479 S. u. VI, S. 481–950. ISBN 978-3-447-11245-1 u. ISBN 978-3-447-11747-0
Die Reihe „Constitutiones et acta publica imperatorum et regum" [Const] ist Teil der ‚Abteilung' Leges (Rechtstexte) der ruhmreichen Monumenta Germaniae Historica [MGH]. Sie hat zur Geschichte der Verfassung und des Verfassungsbewusstseins in Deutschland seit 1893/1896) in einer windungsreichen, von zwei Weltkriegen und vielfach schwierigen Zeitläufen immer wieder gestörten Folge eine höchst ansehnliche Reihe von Editionen vorgelegt). Constitutiones (gesetzliche Festlegungen) und acta publica(öffentliche Rechtshandlungen) der Herrscher wollte sie sammeln, kritisch erfassen und in chronologischer Folge präsentieren.
Von Anfang an war nicht beabsichtigt, die Belege einer bestimmten Textsorte in zumindest angestrebter Vollständigkeit vorzulegen, wie das die Absicht ist in anderen Reihen der MGH, insbesondere in den benachbarten Diplomata-Bänden. Es ging vielmehr darum, Zeugnisse mit erkennbarem Bezug zur Reichsverfassung aufzuführen, nach heutigem Verständnis etwa Verhandlungen von Königen, Friedensschlüsse, Vollmachten für Gesandte oder auch Gesandtenberichte, Standeserhebungen (insbes. Erhebungen in den Fürstenstand), Verpfändungen von Reichsrechten und Zolleinkünften, Belohnungen aller Art im Reichsinteresse, Erklärungen über Reichsrechte, Gerichtsurteile in Reichssachen, Fürsten- und Städtebündnisse im Blick auf das Reich, (Geschäfts)Ordnungen für Herrscherhof und zentrale Gerichte und dergleichen). All das sollte in exemplarischer, jedoch damit auch unvermeidlich subjektiver Selektion vorgelegt werden, was den jeweiligen Bearbeitern eine hohe Verantwortung für die künftige Brauchbarkeit ihrer Auswahl zuwachsen lässt.
Beginn und Ende der gesamten Zeitreihe war gleich beim Start der Reihe festgelegt worden: Sie sollte mit der Regierung Heinrichs I. anfangen, d. h. offenbar nach dem Ende der ‚fränkischen' Karolinger, und dann bis zum Tod Karls IV. († 1378) geführt werden. Dies ins Auge gefasste Ende der Reihe erklärt sich nicht etwa aus der Annahme, mit dem Tod Karls IV. sei ein Ende der deutschen Geschichte erreicht. Vielmehr war es die Beobachtung der schon damals zunehmend schwer übersehbaren Masse von Erzeugnissen der Herrscherkanzleien in Spätmittelalter und Frühmoderne, die diesen Schlusspunkt nahelegte. Diese Entscheidung wurde noch dadurch unterstützt, dass für die Zeit ab 1376 in der Serie der „Deutschen Reichstagsakten" (1887 war Bd. I erschienen) außerhalb der MGH ein eigenes Publikationsinstrument für Verfassungsfragen im Anschluss an die MGH-Reihe zur Verfügung stand.
Der für die MGH gewählte Reihentitel „Constitutiones et acta publica" zeigt an, dass man wohl zu Beginn der Arbeiten meinte, verfassungsrelevante Erlasse und entsprechende urkundliche Erklärungen der jeweiligen Herrscher könnten ausreichend Aufschluss über die Verfassungszustände des Landes liefern, sodass deren chronologisch gereihte Vorstellung dann gleichsam eine ‚Gesetzessammlung' zum ‚Öffentlichen Recht' angeboten hätte. Dieses mögliche Missverständnis hat dann aber nach einer überlangen Publikationspause seit den letzten erschienenen Bänden und Faszikeln (1927/1936) in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts dazu geführt, ab Const IX/1 (Weimar 1979) den alten Reihentitel zwar zu belassen, auf dem Titelblatt des Einzelbandes jedoch ermäßigend hinzuzufügen: „Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung"). Diese Formulierung hat seither sämtliche Folgebände und Lieferungen geprägt, die vor und nach der ‚Wende' erschienen sind – mit der Ausnahme allein des „Supplements" (Const II Suppl., 1996), welches nur die Konstitutionen von Melfi des Staufers Friedrich II. für sein Königreich Italien enthält: dafür wäre der Titelzusatz ganz unpassend gewesen! Die zusätzliche Überschrift ist dann nach der Umstrukturierung der Editionsarbeiten nach der deutschen Vereinigung beibehalten worden. Sie weist den Bearbeitern eine womöglich noch größere Freiheit und eine breitere Verantwortung zu. Const IX (für das Berichtsjahr 1349) ist 1974–1983 erschienen, Const X (für die Regierungsjahre 1350 bis 1353) noch 1979–1991, Const XI (der die Regierungsjahre 1354–1356 und damit auch Romzug und Kaiserkrönung 1354–1355 erfasst) wurde 1978–1992 vorgelegt.
Die Equipe, die nach der ‚Wende' bei der neu eingerichteten Arbeitsstelle der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Nachfolge der vorangegangenen Bemühungen der Arbeitsstelle der Akademie der DDR für die Regierungszeit Karls IV. eingesetzt wurde, hat ihre Ergebnisse rascher als erwartet vorgelegt: Die vier für die Fortsetzung jetzt verantwortlichen Herausgeber, gestützt auf langwierige, durch Kriegsschäden aber teilweise vernichtete Vorbereitungen durch eine ganzen Reihe von Vorgängern, konnten in rascher Folge ihre Editionen realisieren: Const XII (für die Regierungsjahre 1357–1359) erschien 2013 bei dem künftig auch sonst für die MGH regelmäßig tätigen Verlag Harrassowitz (heute ein Teil der de Gruyter-Verlagsgruppe). Const XIII/1 (zu 1360) kam 2016 heraus, Const XIII/2 (zu 1361) dann 2017. Der (hier anzuzeigende) Doppelband Const XIV/1–2 (für 1362–1365) ist dann in immer noch eng getakteter Folge 2020 und 2021 erschienen (wirklich steht Teilband 2 seit dem 31. Januar 2022 zur Verfügung). Beide Teile gehören zusammen, sie werden durch die gemeinsamen Register in Bd. XIV/2 erschlossen (Namenregister 761
Der vorliegende Doppelband, der einem relativ ruhigen Abschnitt in der Regierungszeit Karls IV. gewidmet ist, kann also als exemplarische Spiegelung der alltäglichen politischen Probleme in der kaiserlichen Kanzlei des 14. Jahrhunderts genommen werden. Er präsentiert gleich im Vorwort (Const XIV/1, Xf.) den für die Berichtszeit ungewöhnlichen und unerwarteten, offenbar aber weitgehend reibungslosen Übergang der Kanzleileitung (bzw. der Kanzlerwürde) von Johann von Neumarkt auf Bischof Berthold von Eichstätt (im Jahre 1364), anscheinend etwas ratlos, ohne eine Lösung des Rätsels mehr als nur andeuten zu wollen: Man wird diese Vorsicht als verantwortungsvollen Umgang mit einer unklaren Quellenlage erklären dürfen.
Es ist unmöglich, einen repräsentativen roten Faden durch die insgesamt 680 Nummern der hier in breiter Auswahl präsentierten Quellenstücke zu bieten, das würde eine definitive Systematik der gesamten politischen Praxis von Karls IV. Regierungszeit voraussetzen. Es seien jedoch einige Themen und Stücke benannt, die ein breiteres Interesse an dem Doppelband wecken könnten. In die Richtung außenpolitischer Interessen zielen Entscheidungen zugunsten König Waldemars IV. von Dänemark, dessen Privilegien etwa eigens vom Kaiser bestätigend erneuert werden (nr. 296 S. 295f.). An den dänischen König direkt soll wenig später keine geringere Stadt als Lübeck ihre jährliche Reichssteuer entrichten (nr. 387 S. 404).
Von Entscheidungen, die die Reichsverfassung insgesamt betrafen, findet sich die Verleihung der durch den Tod Philipps I. vakanten Grafschaft Burgund (nr. 2 S. 11–14) als unmittelbares Reichslehen an Herzog Philipp von Tours, den späteren Philipp den Kühnen von Burgund, die der Kaiser nur nach Rücksprache mit den namentlich aufgezählten Kurfürsten und nach empfangenem Lehnseid Phi-lipps (unter der höchsten Strafandrohung von 100 000 Mark Goldes) ausgestellt hat. Nr. 443 (466–469) anerkennt die Lehnshängigkeit von Kaiser und Reich der faktisch von Bernabò Visconti (Mailand) abhängigen Markgrafschaft Saluzzo durch förmliches kaiserliches Einverständnis mit der geschaffenen Lage, doch ohne kurfürstliche Willebriefe dafür einzuholen. Die Erhebung des Burggrafen von Nürnberg in den Reichsfürstenstand wird in zwei Urkunden (lateinisch und deutsch in Parallel-kolumnen gedruckt) verbrieft „mit rate der fursten, graven, freyen und edlen, unserr und des reichs getrewen, mit rechter wizzen und mit keiserlicher mechte vollenkomenheit" (nr. 206 S. 191–197, Zitat 192
Ansonsten werden immer wieder Entscheidungen im lehnrechtlichen Verband beurkundet, etwa die Erlaubnis einer Aufwertung eines Dorfes durch die Anlage von Wall und Graben sowie die Einrichtung eines Galgens, eines Hochgerichts und/oder eines neuen Wochenmarktes bis hin zu einer Anerkennung als (Minder-)Stadt (nr. 376 S. 397; nr. 382 S. 401f.; nr. 397 S. 413f.; nr. 403 S. 419; nr. 471 S. 500f.).
Die Mehrzahl der hier dokumentierten Maßnahmen aber stellen fiskalische Anweisungen von fälligen städtischen Reichssteuerbeträgen an genannte Personen, denen der Herrscher sich verpflichtet weiß. An bestimmte Empfänger werden solche Steuereinnahmen direkt oder auf Dauer angewiesen oder auch nur bis zur Erreichung einer bestimmten Gesamtsumme, die damit dem Empfänger versprochen wird. Oder sie werden auch auf Dauer bis zu einer möglichen „Ablösung" des Pfandes durch den Herrscher oder einen Nachfolger angewiesen. Sogenannte Turnosen (ursprünglich Groschen von Tours) werden als monetär fixierte Anteile an einer Warenzollerhebung – z. B. an Wein etwa in Koblenz, Bacharach oder bei Hanau – bzw. auch als Anteil an einem Zoll auf den Verkauf von Eisen (nr. 5 S. 3–4) oder Vieh (nr. 217 S. 216f.; nr. 346 S. 364f.; nr. 374 S. 395; nr. 396 S. 413; nr. 413 S. 427–429) zugestanden. Dem Bischof von Utrecht wird eine Turnose auf jedes Fass Bier gewährt, das in der Stadt sowie in den Siedlungen des bischöflichen Tafelgutes unter Zugabe von Hopfen gebraut wird (nr. 370 S. 392f.), weil der Aussteller wünscht, dass der Bischof, der wegen dieser neueren Fabrikationsmethode seit einigen Jahren Einkünfte verloren hat, künftig Vorteile eben davon erhalte (
Bestimmungen zugunsten von und in Verfahren des Hofgerichts sind relativ häufig, sodass dieses Reichsgericht auch im deutschen Wortregister (921
Mit all diesen Hinweisen kann die Fülle unterschiedlicher weiterer rechts-geschichtlicher Aspekte nicht annähernd vollständig vorgestellt werden. Auch kann nicht der Versuch gemacht werden, aus der langen Belegreihe den Zustand der spätmittelalterlichen Reichsverfassung im Ganzen präzise zu erheben. In dem jetzt vorgelegten DoppelbandXIV/I–II der Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung der MGH wird historischer und rechtshistorischer Forschung jedenfalls ein reiches Tableau praktischer Verfassungswirklichkeit im deutschen Mittelalter für die drei Berichtsjahre zur Verfügung gehalten. Es wird von Findigkeit, Interesse und Frageintensität seiner Benutzer abhängen, ob, wie und wo das fruchtbar wird. Chancen werden hier reichlich eröffnet.
By Jürgen Miethke
Reported by Author