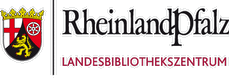Ernst-Dieter Hehl, Gregor VII. und Heinrich IV. in Canossa 1077. Paenitentia – absolutio – honor. Monumenta Germaniae Historica, Studien und Texte, Bd. 66. 2019 Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 978-3-447-11246-8, € 35,–
„[A]ut iustitiam secundum iudicium eius aut concordiam secundum consilium eius faciam." Kann dieser knappe Satz die Quintessenz von „Canossa" offenbaren und bei der Klärung der alten und dennoch immer aktuellen Frage helfen, wie „es damals eigentlich gewesen ist"? Diese methodische Herausforderung hat Ernst-Dieter Hehl angenommen und eine Monographie vorgelegt, welche nicht die historiographischen Nachrichten, sondern die Aussagen der Hauptbeteiligten in den Mittelpunkt stellt und diese mithilfe des traditionellen Instrumentariums der Quellenkritik auswertet. In der Einleitung (S. 1–8) schildert er den Forschungsstand und setzt sich insbesondere mit der viel diskutierten Canossa-Interpretation Johannes Frieds auseinander, nach welcher es im Januar 1077 zu einer Absolution sowie vor allem zu einem Friedensbündnis zwischen Papst und König gekommen sei. Bekanntlich stützt sich Frieds These auf die historische Memorik, welche den Stellenwert der philologischen Analyse zugunsten der Erinnerungskritik relativiert. Im Fall von „Canossa" (und auch sonst) – so Hehl – sei aber die Textanalyse immer noch geeigneter, zumal Quellen vorliegen, welche im Vorgang selbst entstanden und sich somit einer erinnerungsgeleiteten sprachlichen Umformung entziehen (S. 7).
In Kapitel I (S. 9–24) fokussiert Hehl die Willenserklärung Heinrichs – hier ist oft vom Eid die Rede – und unterzieht den eingangs erwähnten Satz einer eingehenden Analyse. Während „concordiam faciam" unzweifelhaft mit „Eintracht herstellen" zu übertragen sei (S. 20), ließe sich „iustitiam faciam" sowohl als „sich einem Gericht stellen" als auch als „Gerechtigkeit herstellen" übersetzen (S. 14). Letztere Interpretation sei jedoch aufgrund der grammatischen Struktur der Formel sowie der Verwendung des Ausdruckes in den sonstigen Urkunden der Hauptbeteiligten vorzuziehen (S. 22).
In Kapitel II (S. 25–33) beschäftigt sich Hehl mit dem päpstlichen Informationsbrief, den er nicht so sehr als eine Schilderung, Begründung und Rechtfertigung des päpstlichen Handelns, sondern eher als einen integralen Bestandteil der Lösung von der Exkommunikation charakterisiert. Laut zeitgenössischer Bußordnungen war nämlich in ähnlichen Fällen die Öffentlichkeit in Kenntnis zu setzen. Die Vorbedingungen und Ziele der Absolution behandelt der Autor in Kapitel III (S. 34–56), wobei vor allem die Begriffe „securitates" und „honor" Erkenntnis über den Sinn der Vorgänge vom Januar 1077 versprechen. Aus dem päpstlichen Brief und der königlichen „promissio" gehe eine multilaterale Verpflichtung hervor: Gregor werde fortan gegen Heinrichs „honor" und „salus" nichts mehr unternehmen, Heinrich werde seinerseits für die „securitas" und den „honor" Gregors eintreten und gemäß dem päpstlichen Urteil und Rat Gerechtigkeit und Eintracht schaffen. Entscheidend für Gregor sei dabei gewesen, den „honor" der Fürsten mit demjenigen des Papstes zu verknüpfen und den Konflikt zwischen Heinrich und den Großen durch die Charakterisierung Letzterer als „defensores christianae fidei" kirchlich-religiös zu konnotieren (S. 51 f.).
In Kapitel IV (S. 57–73) beschäftigt sich Hehl mit der Frage nach der Datierung der Ereignisse und kommt dabei zu dem Schluss, dass aufgrund des funktionalen Charakters der „securitates" eine Absolution vor dem 28. Januar nicht anzunehmen sei (S. 58). Anschließend setzt sich der Verfasser einmal mehr mit Frieds These einer Trennung zwischen Bannlösung und Friedensbündnis auseinander und zeigt, dass selbst das von Fried stark gewürdigte Zeugnis Arnulfs von Mailand einen Zusammenhang zwischen „venia" und „pacta" erkennen lässt (S. 66). Auf das Scheitern von „Canossa" und dessen methodische Implikationen geht Hehl in Kapitel V (S. 74–89) ein und betont, wie eine Rekonstruktion der Vorgänge vom Januar 1077 vor allem durch Rudolfs Erhebung zum König erschwert worden sei (S. 75).
In den beiden abschließenden Kapiteln (S. 90–115, 116–122) werden die grundlegenden Ergebnisse der Studie zusammengefasst: Das Spezifikum von „Canossa" liege in der untrennbaren Verknüpfung zwischen Religion und „Politik", zwischen der Absolution des Königs und der Anerkennung des „honor" aller Beteiligten (S. 94). Die Wahrung des „honor" von Papst, Herrscher und Fürsten habe mit der kirchlichen Rekonziliation insofern zu tun, als dass die skizzierte multilaterale Verpflichtung neben der „paenitentia" als zentrale Bedingung für die „absolutio" galt. Zwei Exkurse zu dem vermeintlichen Obödienzeid (S. 123–129) und den nordalpinen Spuren eines Vertrags von Canossa (S. 129–136) sowie ein Personen- und Ortsregister (S. 137–142) schließen den Band ab.
Für die Mediävistik ist Hehls Monographie sicherlich eine gute Nachricht, zumal der rigorose philologische Ansatz eine sichere Basis für künftige Diskussionen schafft, ohne dabei jüngere Impulse, etwa zu Konfliktführung und „honor", zu vernachlässigen. Wenige kritische Anmerkungen lassen sich jedoch anführen: Eine stärkere Berücksichtigung der internationalen Forschung – so zum Beispiel der Studien Ovidio Capitanis zum iustitia-Begriff bei Gregor VII. – hätte das Bild noch weiter abgerundet. Nicht wirklich konsequent scheint die oft vorkommende Bezeichnung der Willenserklärung Heinrichs als Eid, denn dabei – wie in Kapitel III präzise dargelegt wird – handelte es sich eigentlich um eine „promissio". Wünschenswert wäre außerdem aus Sicht des Rezensenten eine stärkere Betonung des Umstandes gewesen, dass die vorgelegte Deutung von „Canossa" fast ausschließlich Gregors Perspektive wiedergibt – inwieweit sie von den anderen Beteiligten geteilt wurde, muss trotz des hohen Stellenwertes der analysierten Aussagen dahingestellt werden. Doch schmälern diese wenigen Bedenken keineswegs den beachtlichen Wert einer Studie, welche ohne Zweifel weitere Beschäftigung mit dem aufgeworfenen Themenkomplex anregen wird. Canossa must go on.
By Étienne Doublier
Reported by Author