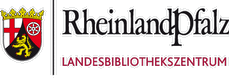Der Beitrag wurde im Rahmen des Jahrbuchs der Psychoanalyse auf der Verlagshomepage
Sie [die Erziehung] sündigt außerdem darin, daß sie ihn [den jugendlichen Menschen] nicht auf die Aggression vorbereitet, deren Objekt er zu werden bestimmt ist. Indem sie die Jugend mit so unrichtiger psychologischer Orientierung ins Leben entläßt, benimmt sich die Erziehung nicht anders, als wenn man Leute, die auf eine Polarexpedition gehen, mit Sommerkleidern und Karten der oberitalischen Seen ausrüsten würde (S. Freud [
Nun ist also das eingetreten, was angeblich keiner (mal wieder) für möglich gehalten hat: Krieg! Freud schrieb 1915 in Zeitgemäßes über Krieg und Tod: „Der Krieg, an den wir nicht glauben wollten, brach nun aus und er brachte die – Enttäuschung" (Freud [
Gar nicht vorstellbar war uns ein Krieg in Europa, schlimmer noch, ein Krieg, der schnell zum Flächenbrand werden oder – noch schlimmer – zu einer Explosion führen kann, „wie sie die Welt", so Putin sinngemäß, „noch nie gesehen hat". Vor wenigen Tagen hat er es so angedeutet: Wer sich den russischen Sicherheitsinteressen (wie von ihm definiert, eher jetzt immer deutlicher werdende Großmachtinteressen) in den Weg stellt, muss mit nie dagewesenen Konsequenzen rechnen. Was könnte damit anderes als die atomare Drohung gemeint sein? Aber nur wenige wagen das bisher[
Damit ist völlig klar: Sollte sich jemand Putins Willen entgegenstellen, sollte man ihn nicht (noch ein weiteres Mal) falsch einschätzen. Die Beschäftigung mit der nuklearen Bedrohung hat mir in den letzten Jahren manchmal den Schlaf geraubt[
In einer lesenswerten Arbeit legte die kanadische Politikwissenschaftlerin und Psychoanalytikerin Steinberg ([
Mein kurzes Fazit aus meiner erneuten intensiven Beschäftigung mit dieser Thematik lautet: Es wird und kann keine schnelle Lösung des nuklearen Dilemmas (wie generell der gesamten Sicherheitspolitik) geben. Das gilt gerade jetzt ganz besonders, nachdem Putin über die Ukraine hergefallen ist und er, nicht zum ersten Mal, noch sehr viel Schlimmeres in den Raum gestellt hat. Und das gilt selbst dann noch, wenn man die Fehler des Westens, über die so heftig gestritten wird und über die selbst ExpertInnen immer noch zum Teil völlig widersprüchliche Aussagen machen, einbezieht: Der brutale Bruch des Völkerrechts bleibt durch nichts zu rechtfertigen, schon gar nicht seine Überlegungen zu nie dagewesener, vernichtender Gewalt. Man sagt von Putin, dass er nicht verlieren könne. Wir im liberaldemokratischen Westen haben also allen Grund, in dieser aufgeheizten Zeit Weitsicht walten zu lassen. Vor allem darf man ihm selbst in diesen Kriegszeiten weder das Gefühl von existenzieller Bedrohung noch von Niederlage vermitteln wollen, und gleichzeitig muss man ihm doch ganz klare Grenzen setzen. Das ist die Aufgabe der Politik und bleibt es, auch wenn schon die Waffen sprechen und wir noch näher am Abgrund sind als jemals zuvor ... Wie soll das gelingen können?
Die erste Voraussetzung ist, dass wir uns keine Illusionen über einen Teil unserer „Natur" machen. Freud hat es kurz und bündig in seinem Brief an Einstein Warum Krieg? so ausgedrückt: „Interessenkonflikte unter den Menschen werden also prinzipiell durch die Anwendung von Gewalt entschieden. So ist es im ganzen Tierreich, von dem der Mensch sich nicht ausschließen sollte" (Freud [
Da wir nun einmal so sein können, wie sich gerade jetzt erneut erwiesen hat, ist jeder Glaube an das prinzipiell oder „eigentlich" Verträgliche und Prosoziale im Menschen – eine Ansicht, die ja auch einige psychoanalytische Richtungen vertreten – illusionär und in der Folge naiv. Nein, der Narzissmus kann sich wirklich an alles heften, auch an die Destruktion. Von daher brauchen wir Verhandlungsbereitschaft und leider gleichzeitig auch militärische Stärke, um mit dieser „Zwei-Säulen-Politik" keinerlei Machtvakuum entstehen zu lassen. Zu dieser Erkenntnis zu kommen, war für mich wie für viele andere ein langer Weg.
Meines Erachtens können wir nur so dafür sorgen, dass wir allmählich von dem nuklearen Abgrund wegkommen, der unser gesamtes Denken und Handeln entweder lähmt oder radikalisiert und dadurch so gefährlich macht. Das ist natürlich ein langfristiges Ziel, das jetzt wieder mehr noch als vor einer Woche auf dem Prüfstand steht.
Bewegen wir uns jetzt aber zu unvorsichtig, kann die gesamte soweit einigermaßen bestehen gebliebene Abschreckung in sich zusammenfallen. Warum schreibe ich das als Psychoanalytiker, der sich bewusst ist, dass diese seine Ausführungen in jeder anderen Hinsicht laienhaft sind? Seit Jahren ringe ich mit Überlegungen, wie das Politische wieder in unsere klinische Praxis eingebracht werden kann, ohne die Psychoanalyse zu politisieren. Wir sind alle voneinander und vom großen Ganzen abhängig. Was nützen die besten Therapien, wenn alles innerhalb eines Tages zu Ende sein kann? Dabei gilt es gleichzeitig, uns unserer in jeder Hinsicht begrenzten Möglichkeiten bewusst zu bleiben.
Einer meiner Patienten brachte es gegen Ende seiner Analyse auf den Punkt: „Jetzt sehe ich meiner Zukunft mit mehr Zuversicht entgegen" – dann schwieg er sehr lange und nachdenklich und fügte ganz leise hinzu: „wenn wir alle das alles denn überhaupt überleben" (Gabriel [
Damit stehen wir PsychoanalytikerInnen vor keinen anderen Schwierigkeiten als die meisten unserer PolitikerInnen auch und, wie ich meine, alle Menschen, die Frieden wollen: Der Wunsch danach ist der richtige Ausgangspunkt und die Arbeit auf dieses Ziel hin erstrebenswert.
Nehmen wir aber Freud und dazu auch erneut unsere jüngsten Erfahrungen ernst, so dürfen wir uns keine Einseitigkeiten erlauben, weder in unserem Menschenbild noch politisch. Jetzt, unter Todesdrohung, ist eine ödipale Verfasstheit, ein binokulares Sehen oder ein Halten mit beiden Händen an all den notwendigen Stellen allerdings noch sehr viel schwieriger zu leisten.
Freud hat unsere Destruktivität wirklich ernst genommen, wenngleich von der politischen Dimension in seinen Behandlungen explizit nicht die Rede ist. Wir sollten uns wieder mehr mit der gesellschaftlichen Dimension des Anti-Libidinösen in uns Menschen beschäftigen. Das ist die entscheidende und überlebenswichtige Frage. Nur eine Psychoanalyse, die das zum Inhalt macht, steht in der Tradition von Freud. Jedenfalls wäre es meines Erachtens kein (Kultur‑)Pessimismus, sondern Realismus, den wir dringend stärken sollten.
Für die Initiative, freundschaftliche Ermutigung und kollegiale Unterstützung danke ich Wolfgang Hegener.
P. Gabriel gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
By Peter Gabriel
Reported by Author
Peter Gabriel Dipl.-Psych., DPG/IPV-Lehranalytiker und Supervisor, ist als Psychoanalytiker seit 1988 niedergelassen in Dossenheim bei Heidelberg.