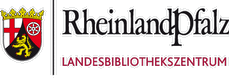Als vor über dreißig Jahren die Sowjetunion zusammenbrach, folgte auch eine Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung, Ausstattung und Diagnosefähigkeit der akademischen Disziplinen, die sich mit dem östlichen Europa und besonders der Sowjetunion beschäftigt hatten. Vertreter:innen einer jüngeren Generation von Osteuropahistoriker:innen verkündeten entsprechend einige Jahre später ein Ende der osteuropäischen Geschichte, so wie sie zuvor jahrzehntelang betrieben worden war. Die Auffassung, die Geschichtsschreibung und Geschichte(n) des östlichen Europas würden Teil der europäischen bzw. westlichen Geschichte, blieb zwar nicht unwidersprochen, hallte im Fach und darüber hinaus aber hörbar nach. Seit den 1990er Jahren gewann gleichzeitig die imperiale Geschichte Russlands mit seiner Betonung von Vielfältigkeit und Aufmerksamkeit gegenüber Peripherien deutlich an Boden. Sie forderte eine ältere nationalstaatliche – russische – geprägte Sicht auf die Geschichte des Zarenreiches und der Sowjetunion heraus und emanzipierte die regionale und nichtrussische Geschichtsschreibung. Die Aufbrüche befreiten Fachhistoriker:innen von vorher dominierenden Paradigmen etwa der Rückständigkeit und eröffneten neue Möglichkeiten. Die Imperialgeschichte zu Russland und zur Sowjetunion hat aber in den letzten Jahren durch die Fokussierung auf imperiale Eliten und die stärkere Rückkehr zur Perspektive des imperialen Zentrums auch implizit zu einer neuen Legitimation imperialer Ordnung geführt. Weitere fachwissenschaftliche Strömungen und Trends wurden kreativ aufgenommen: die Erforschung von Erinnerungskulturen, die Entdeckung des sozialen und kulturellen Raums, von visueller Geschichte, von Vergleichen, Transfers, Zirkulationen und Verflechtungen, von Transnationalität und globaler Geschichte, um nur einige zu nennen. Historiker:innen Europas oder Globalhistoriker:innen begannen zum Teil in ihren Darstellungen auch verstärkt osteuropäische Fragen und Themen aufzunehmen, Osteuropahistoriker:innen griffen eher sporadisch auch westeuropäische Themen und Fragestellungen auf. Bestandsaufnahmen fehlen hier weitgehend und es gibt unterschiedliche Einschätzungen des Erreichten.
Mehr als eine Generation später führt der 2014 begonnene und im Februar 2022 eskalierte Krieg Russlands gegen die Ukraine zu neuen Fragen an das Fach und in dem Fach Osteuropäische Geschichte. Sie betreffen besonders den Platz der Ukraine (aber zum Beispiel auch der Belarus und Russlands) in der osteuropäischen und europäischen Geschichte, gehen jedoch darüber hinaus. Zunächst kehrt das Bewusstsein für konkrete Orte zurück, etwa für die Stadt Mariupol und das dort 1930 gegründete Stahlwerk Azovstal, für die Territorialität der Ukraine und – vermittelt über die Flüchtlingsströme und geopolitische Konstellationen – auch für ihre Nachbarländer Moldova, Polen und weitere Länder. Der osteuropäische Raum, konzeptionell im Rahmen von Area Studies zuletzt globalisiert und auf Verflechtung und Vergleich hin konzipiert, wird gewissermaßen auf sich zurückgeworfen, das landeskundliche oder regionale Wissen über seine Orte und Länder wird aufgewertet und als politisch und kulturell wichtig erkannt – sowohl im Kontext des Nationalstaates Ukraine als auch darüber hinaus als Teil des Wissens über Europa und die Welt.
Wie lässt sich in dieser Hinsicht die deutsche historische Ukraineexpertise beschreiben und bewerten? Nimmt man Institutionalisierungsprozesse als Gradmesser, dann ist die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit der Ukraine in Deutschland bis heute nur schwach ausgeprägt. Sie wurde und wird traditionell universitär und außeruniversitär auf der Basis von Lehrstühlen und Professuren im Rahmen der osteuropäischen Geschichte betrieben. Blickt man auf die institutionellen Anfänge der universitären osteuropäischen Geschichte in Deutschland zurück, dann ist auf mehrere Spezifika hinzuweisen. Zum einen galt das Fach vor allem als Russlandkunde, wie ein Blick auf die erste Professur für osteuropäische Geschichte veranschaulicht. Theodor Schiemann (1847–1921) wurde 1892 zum außerordentlichen Professor der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin ernannt, 1902 erfolgte an der Universität die Gründung eines Seminars für osteuropäische Geschichte und Landeskunde und 1906 Schiemanns Ernennung zum Ordinarius für osteuropäische Geschichte und Landeskunde. Schiemann war ganz auf Russland fokussiert, da für ihn vor allem größere Staaten, ihre Geschichten und Kulturen sowie der Staatenwettbewerb geschichtswissenschaftliche Relevanz beanspruchen konnten, wie Ludmilla Gelwich, die Autorin einer neuen Biographie über Theodor Schiemann, resümiert:
„Schiemann charakterisierte die kleinen slawischen Staaten als Marionetten verschiedener politischer Interessen. Deshalb sei für Deutschland auch allein das Erlernen der russischen Sprache und die alleinige Beschäftigung mit der Geschichte, Politik sowie der Ökonomie Russlands von Bedeutung."
Dabei hatte sich das preußische Kultusministerium gegen eine Reduktion der osteuropäischen auf eine russische Geschichte und Landeskunde gewandt.
Zum andern repräsentiert Schiemann eine enge Verbindung von Politik, Publizistik und akademisch betriebener osteuropäischer Geschichte. Schiemann trug als regelmäßiger Autor der Berliner Kreuzzeitung den seit den 1890er Jahren wachsenden deutsch-russischen Antagonismus mit und beförderte ihn. Er wurde im frühen 20. Jahrhundert so etwas wie ein Politikberater, seine Berufung war politisch gewollt, aber weniger von den Kollegen der Berliner Universität gewünscht, die sein wissenschaftliches Werk nicht sehr hoch einschätzten.
Ein drittes Kennzeichen soll hier noch ergänzt werden: Die Ukraine, die im Ersten Weltkrieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit wachsende politische Aufmerksamkeit erfahren hatte und zu der zumindest eine ausführlichere Landeskunde veröffentlicht wurde, erfuhr in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg kaum geschichtswissenschaftliche Beachtung, anders als an den Universitäten in der Habsburgermonarchie, in der seit der ersten Teilung Polen-Litauens 1772 eine kompakt siedelnde ukrainische Bevölkerung lebte (Ostgalizien, Bukowina). Dort gab es ein breiteres multidisziplinäres, unter anderem auch historisches Interesse an der Ukraine, etwa an der Universität Wien. In Österreich-Ungarn gab es auch seit 1894 an der Lemberger Universität eine Professur für „Allgemeine Geschichte mit der besonderen Berücksichtigung Osteuropas" (also nicht etwa explizit für die ukrainische Geschichte!) mit ruthenischer (d. h. ukrainischer) Vortragssprache, die mit dem ukrainischen Historiker Mychajlo Hruševs'kyj (1866–1934) besetzt wurde, der mit seinen zehn Bänden zur ukrainischen Geschichte zum Doyen der ukrainischen Geschichtsschreibung schlechthin aufstieg. In Deutschland entstand zwar 1926, nach der gescheiterten Staatsgründung der Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg und der Bildung einer Sowjetrepublik Ukraine, das von der ukrainischen monarchistischen Emigration in Berlin gegründete Ukrainische Wissenschaftliche Institut, es strahlte aber nicht weiter auf die allgemeinere historische Forschung aus, und an den Universitäten entstanden in der Zwischenkriegszeit nur sehr vereinzelte historische Arbeiten zur Ukraine. Es kam zu einer Spaltung oder Distanz zwischen einer kaum ausgeprägten universitären Forschung über die Ukraine und der institutionalisierten, aber isolierten Forschung der ukrainischen Emigration. Sie publizierte in den 1930er und Anfang der 1940er Jahre einige allgemeine und nationalukrainische Darstellungen zur Ukraine in deutscher Sprache. Eine umfassendere Erforschung der historischen Ukraineforschung während der nationalsozialistischen Zeit fehlt bisher, allerdings liegen exemplarische Untersuchungen vor, die bisher nur von sehr begrenzten wissenschaftlichen Aktivitäten zeugen. Vielleicht ist die Forschung hier über die politisierte „deutsche Ostforschung" auch auf populäre Vorstellungen der Ukraine auszuweiten.
Nach 1945 fand die ältere ukrainische Geschichte an den Universitäten zunächst ein gewisses Interesse, das jedoch bald nachließ. Die Forschung über Osteuropa war in den ersten Jahren nach 1945 wegen fehlender Lehrstühle an den Universitäten zunächst noch stark auf die außeruniversitären Institute konzentriert gewesen, wie etwa beim 1952 in München gegründeten Osteuropa-Institut. Ihr erster Direktor, der Wiener evangelische Theologe und Ostkirchenhistoriker Hans Koch (1884–1959), war zwar ein umstrittener Kenner der ukrainischen Geschichte, setzte aber in den 1950er Jahren eher einen Akzent auf Interpretationen der aktuellen sowjetischen Politik. Sein enger Bezug zur Politik ist auch daran erkennbar, dass er als Berater Bundeskanzler Konrad Adenauer auf seiner Moskaureise 1955 begleitete. Mit der tagespolitischen Ausrichtung setzte er eine Tradition aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg fort. Die 1950 in München wiedergegründete Ukrainische Freie Universität, eine Privatuniversität, die 1921 in Wien eröffnet, aber bald nach Prag und nach 1945 nach München verlegt worden war, konnte dagegen an die Institutionalisierung der Ukraineforschung der ukrainischen Emigration in der Zwischenkriegszeit anschließen. Sie wirkte weitgehend isoliert von der allgemeinen universitären und außeruniversitären Forschung in Westdeutschland. Seit den 1950er Jahren setzte mit der Gründung einer Reihe von Lehrstühlen zur osteuropäischen Geschichte eine Verwissenschaftlichung des Faches ein, die auch mit einer distanzierten Haltung zur Instrumentalisierung durch die Politik einherging. Das mag dazu beigetragen haben, dass das Fach das Ende der Sowjetunion unvorbereitet traf. Die westdeutschen Universitäten bildeten von den 1960er bis in die 1980er Jahre kaum noch eine historische Expertise zur Ukraine und zur nationalen Vielfalt der Sowjetunion aus, osteuropäische Geschichte war Geschichte Russlands oder Polens.
Kontinuitäten und Neuorientierungen kennzeichneten die nach 1991 aufblühende historische Ukraineforschung in Deutschland. Zum einen konnte sie an die engagierte Forschung zweier Lehrstuhlinhaber für osteuropäische Geschichte seit den 1980er Jahren anknüpfen, Andreas Kappeler an der Universität zu Köln und Frank Golczewski an der Universität Hamburg, die beide auch fundamentale Publikationen zur Geschichte der Ukraine veröffentlichten und wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden konnten. Die Forschungsschwerpunkte der Professur von Andreas Kappeler lassen sich als die sozialgeschichtliche Erforschung der ukrainischen nationalen Bewegung und die Erforschung der Ukraine als Teil der Imperialgeschichte (zu den imperialen Peripherien), die Schwerpunkte von Frank Golczewski als Erforschung des ukrainischen Nationalismus und der deutsch-ukrainischen Beziehungen im Zeitalter der Weltkriege kennzeichnen.
Die ukrainische Emigration spielte bis 2014 keine größere Rolle in der Entwicklung der historischen Ukraineforschung in Deutschland, obwohl sich die Kooperationen mit ukrainischen Historiker:innen in der Ukraine nach 1991 intensivierten, zum Teil auch mit der ukrainischen Diaspora in Nordamerika. Die Ukrainische Freie Universität blieb auch in diesem Zeitraum stark auf sich selbst bezogen.
Die Besetzung der Krim durch Russland und der Kriegsbeginn im Osten der Ukraine im Jahr 2014 zeigen, dass politische Kontexte auf die historische Ukraineforschung zurückwirken. An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder wurde eine Professur für Entangled History of Ukraine geschaffen, die mit dem aus Dnipro stammenden Spezialisten für die ukrainisch-polnische Beziehungsgeschichte Andrii Portnov besetzt wurde. Sie konnte vor allem im Nordosten Deutschlands, aber auch international Wirkung entfalten und ist auch als ein wichtiges Zeichen dafür zu werten, dass Historiker:innen aus der Ukraine Dauerstellen im deutschen Universitätswesen erlangen können. Auch meine 2016 geschaffene Professur an der Universität Regensburg in Verknüpfung mit dem Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung IOS („Ost- und südosteuropäische Geschichte mit besonderer Beachtung der Geschichte Russlands/der Sowjetunion und der Ukraine", also mit expliziter Nennung der Ukraine) ist in diesem Kontext zu nennen. 2015 entstand auf Initiative des Münchener Osteuropahistorikers Martin Schulze Wessel (LMU München) zudem beim Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands e. V. die Deutsch-Ukrainische Historikerkommission (DUHK), die seitdem in Veranstaltungen und Publikationen die neuere ukrainische Geschichte sowie die deutsch-ukrainischen Beziehungen erforscht, sich für die Nachwuchsförderung, für die Gründung eines Deutschen Historischen Instituts in Kiew und vor allem auch für den Wissenstransfer in die Gesellschaft einsetzt. Eine mittlere Generation von Historikerinnen und Historikern hat in den letzten Jahren wichtige Beiträge zu zentralen Themen wie der Ukraine im Zweiten Weltkrieg (Tanja Penter, Kai Struve), zur Kirchengeschichte (Katrin Boeckh), zur Technikgeschichte (u. a. Tschernobyl, Anna Veronika Wendland), zur Geschlechtergeschichte (Dietlind Hüchtker) oder zur Geschichte der Krim (Kerstin S. Jobst) vorgelegt.
Wie schon 2014/15 so entzünden sich auch seit Februar 2022 wieder Diskussionen an der Frage, ob die wissenschaftliche Expertise zur Ukraine inklusive der historischen Expertise in Deutschland ausreichend ist. Verwiesen wird auf die geringe Zahl von Professuren und Lehrstühlen mit Ukraineexpertise, blank spots wie die nicht vorhandene Forschung zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte der Ukraine, fehlende innovative geschichtswissenschaftliche Perspektiven (transnationale Geschichte etc.), mangelnde Vermittlung von Fachwissen in die Öffentlichkeit und Politik und den Abbau von Expertise durch die Schließung von Lehrstühlen zur osteuropäischen Geschichte nach 1991 (etwa an den Universitäten des Saarlands, in Frankfurt am Main oder jüngst in Köln). Gleichzeitig ist in den zurückliegenden Jahren aber auch eine neue Vielfalt an Forschungsschwerpunkten und Kooperationen entstanden, und Themen der historischen Ukraineforschung sind von einer wachsenden Zahl von Historiker:innen aufgegriffen worden, etwa an den Leibniz-Instituten mit explizitem Osteuropabezug in Regensburg (IOS), Leipzig (GWZO) und Marburg (HI) und an den Lehrstühlen für osteuropäische Geschichte der Universität Heidelberg (Tanja Penter), der Universität Freiburg (Dietmar Neutatz), der Universität Bonn (Martin Aust) und seit kurzem der Universität Münster (Ricarda Vulpius), deren Stelleninhaber:innen mindestens eine Qualifikationsarbeit mit Ukrainebezug vorgelegt haben. Die historische Ukraineforschung in Deutschland ist beileibe kein Ein-Thema-Fach über „Nationalismus, Antisemitismus und Kollaboration mit den Nazis" mehr. Da es auch individuelles Interesse an der ukrainischen Geschichte an anderen Universitäten und ein wachsendes Interesse an der Geschichte und Kultur der Ukraine an deutschsprachigen Universitäten in der Schweiz und Österreich gibt, ist die Situation im Vergleich zu anderen Regionen wie etwa dem Kaukasus, Zentralasien, aber auch zu Südosteuropa nicht desaströs. Insgesamt ist jedoch eine Aufwertung der Geschichte der Ukraine im Rahmen der osteuropäischen Geschichte notwendig. Sie muss stärker institutionalisiert werden, thematisch breiter ausgerichtet sein und theorie- und methodenorientierter werden.
Es ist aber fraglich, ob Professuren oder Lehrstühle mit einer expliziten Ukraine-Denomination tatsächlich Abhilfe schaffen können. Denn das eigentliche Problem scheint nicht die allgemeine Denomination „Osteuropäische Geschichte" zu sein, sondern dass die Mehrheit der Stelleninhaber:innen darunter in fahrlässiger Reduktion häufig nur traditionelle russische Geschichte verstanden haben und diese Fokussierung in Bewerbungsverfahren auch eine Rolle gespielt hat. Den starken Russlandbezug der deutschsprachigen osteuropäischen Geschichte kann man in der augenblicklichen Diskussion im Fach vor allem daran erkennen, dass Kolleg:innen zwar zunächst die Notwendigkeit einer stärkeren Ukraineexpertise anerkennen, im Folgenden aber argumentieren, dass wir Russland nicht vergessen dürfen. Die latente oder offene Ignoranz gegenüber der Geschichte der Ukraine, die sich erstaunlicherweise sogar nach 2014 fast ungebrochen fortgesetzt hat, gilt es zu Gunsten einer neuen Vielfalt aufzubrechen, die bereits nach 1991 gefordert, aber nicht eingelöst wurde. Dies wäre ein erster Schritt der momentan diskutierten so genannten De-Kolonisierung der Osteuropawissenschaften im Bereich der Geschichtswissenschaften. Das aktuelle Interesse an Verflechtung, Transnationalität und verwandten Orientierungen kann sich dabei positiv auswirken. Dazu muss auch gehören, dass die gegenwärtig in Deutschland lebenden und an einer Reihe von Universitäten und außeruniversitären Instituten aufgenommenen ukrainischen Gastwissenschaftlerinnen längerfristige Möglichkeiten der Kooperation und Integration erhalten. Die für das 20. Jahrhundert typische Distanz zwischen einer separierten und institutionalisierten Ukraineforschung der ukrainischen Emigration oder Diaspora sowie der deutschen historischen Ukraineforschung, die sich noch in aktuellen Darstellungen zum Thema spiegelt, sollte zu Gunsten vielfältiger Kooperationsformen überwunden werden.
Der Ausbau von historischer Ukraineexpertise kann nur gelingen, wenn neben aktualitätsgetriebenen Themen das fachwissenschaftliche Potential historischer Ukraineforschung deutlich gemacht werden kann. Dieses Potential ist bisher kaum ausgeschöpft worden, und dazu sollen hier vor dem Hintergrund eigener Forschungsinteressen einige Perspektiven angedeutet werden. Dabei lässt sich bei einer Beobachtung ansetzen: Auf der einen Seite hat ein Beitrag zweier renommierter ukrainischer Historiker in einer kürzlich erschienenen Publikation zum Stand der Geschichtsschreibung über die Ukraine darauf aufmerksam gemacht, dass die ukrainische (und internationale) Historiografie weit von einem Konsens über die nationale Geschichte der Ukraine entfernt ist, obwohl sie bereits seit 1991 im Zentrum der ukrainischen Geschichtsschreibung steht und es bereits vor über zehn Jahren ein Plädoyer für eine transnationale Öffnung der ukrainischen Geschichtswissenschaft gegeben hat. Die nationale Frage wird weiterhin ein zentraler Gegenstand der Geschichtsschreibung der Ukraine von der Frühen Neuzeit (Kosakenzeit) bis zur Zeitgeschichte sein. Auf der anderen Seite gibt es in der deutschen historischen Ukraineforschung und darüber hinaus kaum klassische oder neuere sozial-, wirtschafts-, migrations- oder kulturgeschichtliche Untersuchungen zur Ukraine ohne mehr oder weniger direkten Bezug zur nationalen Frage. In der Regel werden diese Themen von der Russlandhistoriographie aufgegriffen, die Ukraine wird dagegen nur als Fallbeispiel bei Themen der Nationalitätenpolitik oder verwandten Themen berücksichtigt. Diese Verkürzung gilt es zu überwinden, um zu einem facettenreicheren Bild von der Ukraine und Osteuropas zu gelangen.
Ich möchte am Beispiel der ukrainischen Revolution von 1917–1921, als am Ende des Ersten Weltkrieges 1918 erste Staatsbildungsversuche der modernen Ukraine standen, auf einige Möglichkeiten der Perspektiven- und Themenerweiterung hinweisen. Denn angesichts der aktuell bedrohten Staatlichkeit der Ukraine verdienen die Staatsbildungsversuche der modernen Ukraine im 20. Jahrhundert deutlich mehr Aufmerksamkeit, besonders der Frieden der Mittelmächte mit der gerade proklamierten, aber durch die Bolschewiki und ihre Rote Armee militärisch gefährdeten Ukrainischen Volksrepublik vom Februar 1918 in Brest-Litowsk, der als erster Friedensschluss im Ersten Weltkrieg gilt. In der deutschen Historiographie ist vor allem der im März 1918 folgende Friedensschluss mit Sowjetrussland als so genannter Diktatfriede präsent. In der nichtdeutschen Geschichtsschreibung überwiegt eine abgewogenere Beurteilung des bzw. der Friedensschlüsse. Die Geschichte dieses Friedensschlusses und ukrainischer Staatlichkeit nicht aus der Perspektive der dominanten Mittelmächte zu schreiben, sondern die Ukraine und ihre politische Elite als politisches Subjekt aufzufassen und zu erforschen, würde einen großen Fortschritt bedeuten. Dazu sind jüngst erste Schritte unternommen worden. Die Geschichte der ukrainischen Revolution und ihrer fragilen Staatlichkeit steht noch im Schatten der russischen Revolution. Dabei könnte mit der Perspektive asymmetrischer Machtbeziehungen ein neuer Blick erstens auf die für den Kontext der Friedensverhandlungen wichtigen ukrainisch-russischen Beziehungen geworfen werden (Sowjetrussland hatte im Dezember 1917 der Ukraine den Krieg erklärt); zweitens auf die europäische Geschichte, die von ihrem Rand und von Marginalitätserfahrungen her erforscht und erzählt werden könnte; und drittens auf globale Vergleichsmöglichkeiten (z. B. mit Palästina).
Zu den aktuellen Themen mit wirtschaftshistorischem Bezug, die sowohl regional als auch nationalstaatlich oder global entwickelt werden können, aber auch Öffnungen hin zur politischen oder Kulturgeschichte ermöglichen, gehören in den letzten Jahren etwa die Infrastrukturgeschichte sowie neuerdings die Geschichte natürlicher Ressourcen. Zur Geschichte der modernen Infrastrukturen der Ukraine liegt bisher kein einziger Beitrag vor, zur Geschichte natürlicher Ressourcen ebenfalls noch nicht, obwohl der weit zurückreichende Mythos, der die Ukraine als reich an Schätzen und zumal als „Kornkammer" ausweist, doch eine kritische Erforschung nahelegen würde. Der Ukrainer und österreichische Staatsrat Eugen Lewicky schrieb etwa 1915:
„Auch jetzt bildet die Ukraine für ganz Rußland eine wahre Kornkammer, die Produktion der Ukraine an landwirtschaftlichen Erzeugnissen macht nicht weniger als ein Drittel der Gesamtproduktion Rußlands aus. Den eigentlichen Reichtum der Ukraine bilden aber ihre geradezu unerschöpflichen Schätze an Mineralien. Silber, Blei, Quecksilber, Kupfer werden in Rußland überhaupt nur in der Ukraine gefördert. An Mangan liefert Rußland ein Sechstel der gesamten Weltproduktion, wovon 32% auf die Manganproduktion der Ukraine entfallen."
Neben dem Interesse an einer politischen Schwächung Russlands richtete sich das Interesse der Mittelmächte an der Ukraine während des Ersten Weltkrieges (und besonders zum Ende hin) doch gerade auf ihren Ressourcenreichtum. Das Kaiserreich versorgte sich mit dem für die Eisen- und Stahlgewinnung zentralen Manganerz seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem aus den westgeorgischen Lagerstätten bei Chiaturi. Seit dem frühen 20. Jahrhundert geriet auch verstärkt die südöstliche Ukraine ins deutsche Blickfeld, vor allem die Region um das heutige Zaporižžja. Aus der Perspektive der südöstlichen Ukraine (und dem georgischen Chiaturi) eröffnete sich hier ein internationaler Markt, der in den folgenden Jahrzehnten durch konkurrierende Marktakteure aus Südafrika, Indien und anderen Ländern global geprägt gewesen ist. Manganerz spielte nicht nur bei den Brest-Litowsk begleitenden Wirtschaftsabkommen eine wichtige Rolle, sondern ermöglicht es, die regionale ukrainische Geschichte in eine größere, globalgeschichtliche Perspektive zu rücken.
Vor allem wird es in der nächsten Zeit darum gehen müssen, Themen mit Bezug zur Geschichte der Ukraine in allgemeinere Forschungszusammenhänge aufzunehmen. Dazu könnte für die hier angesprochene Zeitperiode der sogenannten Ukrainischen Revolution beispielsweise das politische Attentat oder politischer Terror gehören. Die Ermordung des Generalfeldmarschalls Hermann von Eichhorn (1866–1918) am 30. Juli 1918 in Kiew durch Sozialrevolutionäre war ein Akt mit symbolischer Bedeutung gegen die Präsenz deutscher und österreichisch-ungarischer Truppen in der Ukraine seit Februar/März 1918. Das deutsche Militär hatte im April 1918 die sozialistisch orientierte Zentralrada der Ukrainischen Volksrepublik zu Gunsten der Herrschaft des Generals Pavlo Skoropads'kij entmachtet, um die ökonomische Ausbeutung der Ukraine zu intensivieren und politische Stabilität herzustellen. Sie erreichte jedoch das Gegenteil, und besonders im Sommer 1918 brachen Bauernproteste im Land aus. Die Attentäter waren russische Linke Sozialrevolutionäre, die kurz zuvor bereits in Moskau den deutschen Gesandten Graf Wilhelm von Mirbach-Harff ermordet hatten, um den Widerstand gegen die harsche wirtschaftliche Ausplünderung im Gefolge des Friedens von Brest-Litowsk zu mobilisieren. Das Attentat verknüpft somit – mindestens – die ukrainische, russische und deutsche Geschichte miteinander.
Für die ukrainische Geschichte lassen sich viele ähnliche Beispiele finden, die ihre Geschichte mit Polen und Russland, aber auch Deutschland oder Rumänien und anderer Staaten verbinden und vergessene oder übersehene Verflechtungen aufzeigen. Das gilt nicht nur für die Zeit der Ukrainischen Revolution, sondern auch für interimperiale Verflechtungen der Jahrhunderte davor oder das 20. und frühe 21. Jahrhundert. Sie in Differenziertheit bei Beachtung asymmetrischer Machtbeziehungen und ukrainischer Subjekthaftigkeit zu untersuchen und darzustellen, könnte die ukrainische Geschichte im Kontext der osteuropäischen, europäischen und der Globalgeschichte aufwerten, indem ihr Integrations- und Innovationspotential im Kontext einer Dekolonisation der historischen Osteuropaforschung gezeigt wird.
By Guido Hausmann
Reported by Author