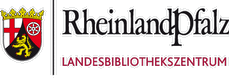Im Rahmen ihres 2008 gestarteten Modernisierungsprogramms haben die russischen Heeresverbände starkes Gewicht auf bataillonstaktische Gruppen (BTG) gelegt. Diese erschienen besonders geeignet für den Einsatz in lokalen und kleinen Kriegen und fanden erstmals Einsatz im Ukraine-Konflikt 2014. Nach den Erfahrungen aus diesem sowie dem Syrien-Konflikt wurden Organisation und Einsatz der BTGs erheblich verbessert. Im Zuge des russischen Angriffskriegs vom Februar 2022 maß Russland der Rolle von BTGs hohe Bedeutung zu, was sich offensichtlich als Irrtum erwies. Dieser Beitrag analysiert die verschiedenen Kriegsphasen und zeigt auf, wie wenig der BTG-Ansatz Russland geholfen hat, seine Kriegsziele zu erreichen, und welche Faktoren für den Ausgang dieses Kriegs bestimmend sein werden.
As part of its modernization program, which began in 2008, Russian Army units placed strong emphasis on battalion tactical groups (BTG). These were particularly suited for use in local and small wars. The first deployment took place in the Ukraine conflict in 2014, and the organization and deployment of BTGs were significantly improved after the experience of that conflict as well as Syria conflict. In the context of the Russian war of aggression of February 2022, strong emphasis was placed on the role of BTGs. This obviously proved to be a mistake. The paper analyzes the different phases of the war and shows how little the BTG approach helped the Russians achieve their war aims and what factors will be determinants of how this war will turn out.
Keywords: Militärstrategie; Militärtaktik; Ukraine-Krieg; Bataillonstaktische Gruppen; Military strategy; military tactics; Ukraine war; tactical battalion groups
Seit dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine am 24. Februar 2022 gehören mechanisierte Verbände und massierte Artillerie sowie der zuvor kaum gekannte massenhafte Einsatz von ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen zum Alltag des dortigen Krieges. Ein tragendes Element beim Einmarsch der russischen Verbände waren sogenannte bataillonstaktische Gruppen (BTG). Diese hatten sich im Donbas-Konflikt 2014/2015 aus russischer Sicht bewährt. Doch inzwischen, zehn Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs, geht Russland offenbar von diesem Konzept wieder ab.
Der vorliegende Artikel zeichnet die Entwicklung des BTG-Konzepts innerhalb der russischen Militärreform nach und erkundet die Ursachen des ersten, zunächst erfolgreichen BTG-Einsatzes im Jahr 2014. Dieser Erfolg wurde zur Grundlage für die Planungen des russischen Angriffs im Februar 2022. Daher beleuchtet der erste Teil dieser Analyse das Wesen der russischen BTGs sowie deren Einsatz anhand einer ausgewählten Gefechtssituation in der Ostukraine im Sommer 2014. Der zweite Teil analysiert die bisherigen Phasen der Kämpfe in der Ukraine und weshalb das BTG-Konzept im 2022 von Russland ausgelösten Krieg nicht länger verfangen hat und welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind.
Die Vermittlung der Wirkung der Einsatzführung der russischen Streitkräfte sowie des Wesens russischer Verbände ist an der österreichischen Theresianischen Militärakademie (TherMilAk) seit Jahren integraler Bestandteil der Offiziersgrund- und Offiziersweiterbildung. Die Entwicklungsabteilung sowie das Institut 1 für Offiziersausbildung werten Konflikte und militärische Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre, so etwa jene in Georgien, in Syrien und vor allem den Ukraine-Konflikt seit 2014, aus und analysieren diese. Dies geschieht auch unter Einbindung moderner Simulationssysteme. Besonders der Ukraine-Konflikt beschäftigt das Lehr- und Forschungspersonal an der TherMilAk schon seit Jahren. So wurde ein reales Gefechtsbeispiel aus dem Jahr 2014, nämlich die Zerschlagung einer ukrainischen Brigadekampfgruppe bei Selenopillja in der Ostukraine, im Detail erforscht, bewertet und analysiert. Zudem wurde dieser Einsatz unter Zuhilfenahme des Führungssimulators der TherMilAk nachgebildet, um den Gefechtsablauf so realistisch wie möglich für die auszubildenden Offiziere darzustellen.
Bereits im Zweiten Weltkrieg und vor allem in der Zeit des Kalten Krieges sah die sowjetische Doktrin es vor, für bestimmte Aufgaben – zum Beispiel als Vorausabteilung – anlassbezogen gemischte Bataillone bzw. „Kampfgruppen" zu bilden. Dieser Ansatz floss ein in die Reform der russischen Streitkräfte, die nach dem Georgien-Krieg 2008 einsetzte. Aus russischer Sicht hatte sich im Georgien-Krieg die Divisions- und Regimentsstruktur als zu starr und unflexibel und daher wenig geeignet für eine moderne Einsatzführung erwiesen. Im Rahmen des Reformprozesses der Streitkräfte nahm Russland die rasante Entwicklung von Wissenschaft, Technologie und sonstigen Rahmenbedingungen zum Anlass, in der Art des bewaffneten Kampfes erhebliche Veränderungen einzuführen. Die „neuen" Konflikte, so die russischen Planer, verlangten neue Methoden der Kriegsführung. Im Mittelpunkt stand die Idee der hybriden Kriege – von Kriegen, die vor allem auf dem Einsatz nicht-militärischer Mittel und Kräfte beruhen, aber militärische Anteile (Kräfte) erfordern, die rasch und effizient einsetzbar sein müssen.
Russlands Streitkräfte waren bis 2008 ausschließlich eine Wehrpflichtigen-Armee mit einem relativ geringen Anteil von „Vertragssoldaten", sogenannten Kontrakniki. Im Zuge der Reformen gab man die alte, wehrpflichtigenlastige „Mobilisierungsarmee" in Teilen auf und überführte sie in kleinere, jedoch besser ausgerüstete und ausgebildete professionelle Streitkräfte mit einem hohen Anteil von Kontrakniki. Damit war es den Brigaden oder Regimentern möglich, nach Mobilmachung ihre volle Kriegsstärke herzustellen oder aber aus den verfügbaren (professionellen) Soldaten kleine, doch rasch einsatzbereite Verbände – die BTGs – zu bilden. Die BTGs entstanden also als Antwort auf die Herausforderungen von lokalen und kleinen Kriegseinsätzen und passten somit in die allgemeine Umgestaltung der russischen Streitkräfte. Erstmals eingesetzt im Ukraine-Konflikt 2014, wurden auf Grundlage dieser Erfahrungen sowie jener des Syrien-Konflikts die Organisation und der Einsatz von BTGs erheblich verbessert.
Die BTG ist eine (zumeist temporär gebildete) taktische Formation, die im Kern ein verstärktes Kampfbataillon abbildet. Dieses besteht aus mechanisierter und motorisierter Infanterie und Kampfpanzern, überaus starken Artillerieanteilen sowie aus Aufklärungs-, Pionier-, Fliegerabwehr-, elektronischen Kampfführung- und Versorgungselementen. Die Basis der BTG besteht aus Einheiten aktiver Brigaden oder Regimenter, die jeweils nach den zu erwartenden militärischen Erfordernissen sowie den Merkmalen der Operationen modular aufgestellt werden. Jede Brigade oder jedes Regiment ist verantwortlich, je ein bis zwei BTGs aufzustellen. Gliederung und Ausstattung einer BTG richten sich einerseits nach der Ausrüstung und Ausstattung des Mutterverbands (Panzerregiment/Brigade oder motorisiertes Schützenregiment/Brigade), andererseits nach den jeweiligen militärischen Aufgaben. Eine BTG ist in der Lage, weitgehend selbstständige Einsätze sowie den Kampf der verbundenen Waffen zu führen. Eine BTG hat eine Stärke von ca. 700 bis 800 Soldaten und verfügt in der Regel über folgende Elemente:
- ein Kommando (in der Regel der Brigade-/Regimentskommandant oder sein Stellvertreter mit einem sehr geringen Anteil an Stabsoffizieren);
- Kampfelemente mit drei motorisierten Schützenkompanien und einer Panzerkompanie (oder umgekehrt);
- einen hohen Anteil an Kampfunterstützungselementen, bestehend aus Granatwerfern, Panzerabwehr, Fliegerabwehr, Pionierelementen, Rohr- und Raketenartillerie (jeweils eine Batterie) sowie Flammenwerfern (TOS-1 oder TOS-1A) zur unmittelbaren Feuerunterstützung bzw. als „Durchbruchsartillerie";
- Führungselemente, die sowohl Aufklärung (inklusive UAV, z. B. vom Typ ORLAN-10) als auch Elemente der elektronischen Kampfführung (EW/Cyber) beinhalten;
- einen relativ geringen Anteil an Einsatzunterstützungselementen, die der BTG zwar logistische Selbstständigkeit, jedoch relativ geringe logistische Reichweite (bis zu drei Tage) ermöglichen.
Graph: Die mögliche Struktur einer BTG
Die Taktik der russischen Streitkräfte fußt direkt auf Erfahrungen und Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg wurde nach russischer Betrachtung auf der operativen Ebene gewonnen, taktische Entscheidungen spielten eine untergeordnete Rolle. Obwohl sich die russischen Streitkräfte seitdem stark verändert haben, blieb die Armee bis zum Beginn der Reformen eine Massenarmee, in der ein Großteil der (älteren) Offiziere nach alten Systemen ausgebildet wurde. Die sowjetischen/russischen Taktiken sollten einfach, effektiv und rasch anwendbar sein. Langwierige Planungsprozesse sind auf der taktischen Ebene nicht vorgesehen. Aus westlicher Sicht haben russische Kommandanten der taktischen Ebene nur begrenzte Möglichkeiten, Pläne für bestimmte Aufgaben zu entwickeln. Vielmehr wählen sie aus einem „Menü" von bekannten „Taktiken" in Reaktion auf bestimmte militärische Lageentwicklungen – ein Vorgehen, das im österreichischen Verständnis eher der Gefechtstechnik (wie auf Kompanieebene) entspricht. Es kommen daher auf Ebene der BTG mit Masse gefechtstechnische Standardverfahren durch den Kommandanten zur Anwendung. Vorteil dieses Systems ist, dass Entscheidungen ohne langfristige Planungen rasch herbeigeführt werden können. Da der „Planungsprozess" viel weniger aufwändig ist, verfügen die BTGs im Vergleich zu westlichen Bataillonen nur über kleine Stäbe.
Die BTGs sind Teil des russischen Bereitschaftssystems und dafür vorgesehen, eher „kleinere" und lokal begrenzte Einsätze zu führen. Sie sind rasch einsetzbar, hoch professionell und bereit, Kampfhandlungen und spezielle Aufgaben – vor allem in der Anfangsphase eines Kriegs – kurzfristig zu übernehmen, um dem Rest der Truppe Zeit zum Abschluss einer möglichen Mobilmachung zu „erkämpfen." Eine BTG kann selbstständig den Kampf der verbundenen Waffen führen, ist jedoch kaum in der Lage, größere Operationen ohne entsprechende logistische Unterstützung zu leiten. Sie ist aufgrund ihrer Autarkie eingeschränkt imstande, „tiefe Gefechte" zu führen, was bisher frühestens ab Divisionsebene möglich war. Solche Aufgabenstellungen konfrontieren BTG-Kommandanten mit der Herausforderung, unterschiedliche Waffen- und Truppengattungen zu koordinieren und komplexe logistische Planungen zu leiten. Nachteilig kann sich dabei der begrenzte Stabsumfang auswirken, weil sich so komplexe Probleme nicht in ihrer Gesamtheit erfassen und in der erforderlichen Tiefe bearbeiten lassen. Getroffene Entscheidungen hängen stark ab von den Erfahrungen und Kompetenzen der jeweiligen Kommandanten. Abgesehen von den Fähigkeiten der russischen Streitkräfte, auf hybride Bedrohungen adäquat reagieren zu können, kam es auf der taktischen Ebene kaum zu wesentlichen innovativen Entwicklungen, die es gebraucht hätte für Entscheidungen, die im russischen Verständnis eigentlich der operativen Ebene zugeordnet sind.
Nach der Annexion der Krim kam es im Frühjahr 2014 auch im Donbas zum Erstarken von prorussischen Milizen, was ab Juni 2014 zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen prorussischen Separatistenverbänden und ukrainischen Sicherheitskräften führte. Im Wesentlichen ging es um die Kontrolle der Oblaste Donezk und Luhansk, die eine Gesamtfläche von ca. 53.000 km² und insgesamt über sechs Millionen Einwohner aufwiesen. Den neu formierten Volkswehren der damals ausgerufenen Volksrepubliken Donezk und Luhansk gelang es im Juni 2014, den Großteil den beiden Oblaste unter ihre Kontrolle zu bringen. Die dort eingesetzten ukrainischen Kräfte – vor allem des Innenministeriums – waren nicht in der Lage, den Raum zu halten. Mitte April startete die Ukraine eine sogenannte „Antiterroroperation" (ATO) mit dem Ziel, im Donbas wieder die Kontrolle zu erlangen. In den Monaten Juni und Juli zeichnete sich ein Erfolg der ATO ab. Die ukrainischen Streitkräfte versuchten, insbesondere den Grenzraum zu Russland zu kontrollieren, um die Nachschubwege für die Separatisten aus Russland abzuschneiden.
Durch die drohende Niederlage der Separatisten geriet Russland unter Zugzwang und stellte grenznah reguläre Streitkräfte in der Stärke von mehreren BTGs bereit. Diese begannen im Juli 2014, die ukrainischen Truppen im Grenzraum gezielt unter Einsatz von Artillerie zu bekämpfen. Am 24. August 2014, dem ukrainischen Unabhängigkeitstag, folgte der Einsatz von mehreren BTGs, um die ukrainischen Streitkräfte zurückzuwerfen und die Separatistenverbände vor einer drohenden Niederlage zu bewahren. Im Raum Selenopillja waren ukrainische Streitkräfte zur Kontrolle eines Grenzabschnitts im Einsatz. Im Detail handelte es sich um eine gemischte Kampfgruppe, bestehend aus Teilen der 24. und 72. mechanisierten Brigade (jeweils zwei verminderte Bataillone), sowie um eine Luftlandekompanie der 79. Luftlande-Brigade. Ihr Auftrag war es, den Grenzraum auf rund 40 bis 50 Kilometer Länge zu kontrollieren und die Wirksamkeit der separatistischen und russischen Soldaten zu verhindern. Die geplante Einsatzführung der Ukrainer sah vor, den Grenzraum mit relativ schwachen Kräften zu überwachen und diese durch bewegliche Elemente, zentral bereitgehalten in einer Forward Operation Base (FOB), zu verstärken. Hier ist darauf hinzuweisen, dass der Einsatz der ukrainischen Kräfte zur Sicherung der Staatsgrenze, ca. 20 bis 30 Kilometer je Bataillon, durchaus der Norm entspricht. Für die Abwehr eines Angriffs ist einem Bataillon jedoch nur ein Gefechtsstreifen von ca. fünf Kilometer Breite und drei Kilometer Tiefe zumutbar. Das stellte die Ukraine vor das Problem, bei Angriffen weniger von einer klassischen Verteidigung aus vorbereiteten Stellungen ausgehen zu können, sondern – je nach Angriffsführung der Russen – eher mit Begegnungsgefechten rechnen zu müssen.
Graph: Die Lage um Selenopillja im August 2014
Am 11. Juli 2014 unternahm Russland einen massiven Artillerieschlag, vor allem von Mehrfachraketenwerfern BM-27 und BM-30, auf die in der FOB bereitgehaltenen ukrainischen Kräfte. Dieses Artilleriefeuer bewirkte auf ukrainischer Seite starke Ausfälle. Insgesamt wurden beim ersten Artillerieschlag 67 ukrainische Soldaten getötet und etwa 170 verwundet, von denen viele ihren Verletzungen erlagen. Des Weiteren wurden Ausrüstung, schwere Waffen, Panzer und Schützenpanzer sowie das Gerät von etwa einem Bataillon vernichtet. Neben den starken Ausfällen und der Problematik der Versorgung der Verwundeten als Folge dieses unerwarteten Angriffes mussten sich die Kräfte in der Tiefe aufsplittern und dezentral bereitgehalten werden. Die russische Seite hatte schon Wochen zuvor im Grenzraum bei Selenopillja eine BTG zusammengezogen. In dieser Zeit kam es zu einem verstärkten Einsatz von Mitteln der elektronischen Kampfführung, zur Aufklärung sowie zur Störung der Ukrainer (betroffen waren auch Mobiltelefone). Zudem setzte Russland zur Aufklärung, zur artilleristischen Feuerleitung, aber auch zur elektronischen Kampfführung Drohnen ein. Am 24. August 2014 erfolgte der Angriff einer BTG auf die im Grenzraum eingesetzten ukrainischen Kräfte. Dies geschah unter Einsatz von Drohnenaufklärung, Steilfeuerunterstützung, EloKa sowie Mehrfachraketenwerfern TOS-1 zur unmittelbaren Feuerunterstützung. Absicht war es, mit einem Bindungsangriff einer verstärkten Kompanie aus dem Westen und dem Hauptstoß der Masse der BTGs aus dem Süden die ukrainischen Kräfte zu zerschlagen. Zu Beginn der Angriffsführung sowie in den Folgephasen setzte die russische Seite auf permanente Drohnenaufklärung, auch zur Steilfeuerleitung. Die Gefechtsidee der russischen Streitkräfte ging auf.
Die Ukrainer reagierten auf den Bindungsangriff sowie auf den Hauptstoß mit dem Versuch, ihre Kräfte im Grenzraum zu verstärken. Dies wurde auf russischer Seite durch Drohnen erkannt. Die ukrainischen Reserven erlitten in dieser Phase, vor allem durch die TOS-1 zur unmittelbaren Feuerunterstützung, erhebliche Verluste. Luftangriffe der Ukrainer wurden durch die Flugabwehrsysteme der BTGs abgewehrt. Am Ende vernichteten die russischen Kräfte in einem finalen Angriff mit Kampfpanzern und Schützenpanzern die verbliebenen ukrainischen Kräfte. Russland hatte somit den letzten Widerstand gebrochen und bei moderaten Verlusten seine Angriffsziele erfolgreich erreicht.
Graph: Ausgangslage der darstellenden Simulation
Die russischen Kräfte hatten nach der Artillerievorbereitung rasch, schmal und tief angesetzt. Jeder ukrainische Widerstand wurde vor allem mittels Kampfunterstützung gebrochen. Eine ähnliche Kampfführung wurde auch in anderen Räumen durchgeführt und fand schließlich ihren Kulminationspunkt in den beiden Kesselschlachten von Ilowajsk (10. August bis 2. September 2014) und Debaltsewe (16. Jänner bis 18. Februar 2015). Die Entwicklungsabteilung an der TherMilAk hat das Gefecht bei Selenopillja nachgestellt und den Ausgang des simulierten Gefechts mit den realen Ereignissen verglichen. Ziel war es, einerseits die Validität der Ergebnisse zu überprüfen und andererseits den auszubildenden Offizieren Bilder des Gefechtsverlaufs zu liefern. Auch wollte man eine Sensibilisierung für die zu erwartenden Bedrohungen und Herausforderungen bei einem Kampf gegen eine BTG erreichen, um so Ableitungen und Konsequenzen für den eigenen Einsatz zu entwickeln. Damit einher geht die Kenntnis über verschiedene gegnerischen Einsatzdoktrinen, deren Waffensysteme und Wirkmittel sowie verfügbare Sensoren. Für die Simulation wurde der Führungssimulator (FüSim) als Simulationssystem verwendet.
Das Gelände im Raum Selenopillja wurde aus simulationstechnischen Gründen in den Bereich der Grenze zwischen Österreich und Ungarn (Region Seewinkel) verlegt. Die dortigen Geländegegebenheiten sind durchaus mit denen der Ostukraine vergleichbar. Selbstverständlich wurde der Einsatz der Truppen dem etwas anderen Gelände angepasst, entspricht aber weitgehend den realen Gegebenheiten von 2014. Die Simulation führte zu einem erstaunlichen Ergebnis: Der nachgestellte „Gefechtsablauf" entsprach nahezu 1:1 der Realität. Sogar die Ausfallszahlen waren fast deckungsgleich. Von insgesamt elf eingesetzten Kompanieäquivalenten bei der Partei Blau wurden ca. 75 Prozent des Geräts vernichtet, es gab 128 Tote und 335 Verwundete – Zahlen, die sich erschreckend mit den realen Ereignissen 2014 deckten.
Insgesamt war die Einsatzführung der russischen BTGs in diesem Gefechtsbeispiel überaus erfolgreich. Zurückzuführen ist dies vor allem auf den Einsatz von Drohnen zur Aufklärung und Steilfeuerleitung, auf den Einsatz von Fliegerabwehr und Pionierkräften, aber vor allem auf den massiven Einsatz von Steilfeuer und unmittelbarer Feuerunterstützung durch die TOS-1. Und der kombinierte Ansatz von Kampfpanzern und Schützenpanzern war der abschließende Todesstoß für einen bereits im Vorfeld massiv geschwächten Gegner.
Das Gefechtsbeispiel bei Selenopillja zeigte, dass eine russische BTG unter den richtigen Rahmenbedingungen, unter Einhaltung der Einsatzdoktrinen und zumutbaren Aufgabenstellungen erfolgreich zur Wirkung kommen kann. Die Erfolge der Gefechte im Donbas in den Jahren 2014 und 2015 brachten die russische Seite zur Überzeugung, dass gleichzeitige, an mehreren Fronten schmal und tief geführte Angriffe für den gewünschten schnellen Vorstoß sorgen können. Man kann daher davon ausgehen, dass diese Erfahrungen die Planungen des russischen Angriffs am 24. Februar 2022 ganz wesentlich beeinflusst haben. Doch auch die ukrainische Seite zog ihre Lehren. Sie erkannte, dass eine Abwehr einmarschierender russischer Kräfte unmittelbar in Grenznähe nicht möglich ist. Bereits dem Einsatz russischer Artillerie von russischem Staatsgebiet aus konnte sie nicht begegnen, da jedes Gegenfeuer einen sofortigen Einmarschgrund geliefert hätte. Und dem folgenden gleichzeitigen Ansatz konnte man vor allem in dem offenen und flachen Grenzraum nichts entgegensetzen. Es war somit klar, dass bei einem neuerlichen russischen Angriff eine Abwehr nur in der Tiefe des ukrainischen Staatsgebiets Erfolg haben könnte. Man musste den russischen Gegner also ins Land lassen, um ihn dort gezielt bekämpfen zu können.
Am 24. Februar 2022 erfolgte in einer von Russland selbst erklärten „Sicherheitsoperation" der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Den Auftakt bildeten gezielte Cyberangriffe und Luftschläge gegen die Kommunikationsinfrastruktur der politischen und militärischen Führung, gegen die ortsfeste weitreichende Fliegerabwehr und die Luftstreitkräfte sowie der Versuch eines Enthauptungsschlags in Kyjiw. Der Einsatz der russischen weitreichenden Präzisionswaffen erfolgte in Maßen. Dies war ein Indiz dafür, dass man nicht mit großem und nachhaltigem ukrainischem Widerstand rechnete. Die in den Monaten vor dem Angriff zusammengezogenen knapp 180.000 bis 200.000 russischen Soldaten kamen in fünf großen Kräftegruppierungen zum Einsatz. Jede Kräftegruppierung wurde durch einen der fünf Militärbezirke Russlands gestellt. Der westliche, südliche, zentrale, nördliche und östliche Militärbezirk bildeten Kräfte in der Stärke von jeweils 30.000 bis 50.000 Soldaten. Das Hauptquartier eines Militärbezirks ist in der Lage, seine eigenen teilstreitkraftübergreifenden Operationen durchzuführen. Es kann zudem seine eigenen organischen Mittel für alle geforderten Wirkungsbereiche einsetzen. Die Militärbezirke unterstehen im Frieden wie im Einsatz dem gemeinsamen Strategischen Kommando in Moskau. Dieses hatte vor dem Angriff am 24. Februar 2022 die Gefechtsaufgaben der fünf angreifenden Kräftegruppierungen definiert. Damit hatte jedes Militärbezirkskommando den Auftrag, das gesetzte Angriffsziel selbstständig zu erreichen.
Die russischen Streitkräfte verfügen über insgesamt zwölf sogenannte kombinierte Armeen. Diese sind das Bindeglied zwischen dem Hauptquartier der Militärbezirke und den Divisionen, Brigaden und Regimentern und nehmen die Funktionen von operativ/taktischen Hauptquartieren wahr. Alle zwölf kombinierten Armeen waren von Anbeginn an der Sicherheitsoperation in der Ukraine beteiligt. Sie wurden zusätzlich durch weitere Kräfte (z. B. Luftlandeverbände und Artillerieeinheiten) verstärkt. Die jeweilige kombinierte Armee wurde in ihrer Struktur so zusammengesetzt, dass sie die an sie gestellte Aufgabe erfüllen konnte. Der Einmarsch in die Ukraine wurde in folgender Gliederung vorgenommen:
Kräftegruppierung „Kiew Nordwest" (gestellt durch den östlichen Militärbezirk):
- 35. und 36. kombinierte Armee;
- Teile der 98. und der 106. Luftlandedivision.
Kräftegruppierung „Kiew Nordost" (gestellt durch den zentralen Militärbezirk):
- 2. und 41. kombinierte Armee;
- Teile der 98. und der 106. Luftlandedivision.
Kräftegruppierung „Charkiw" (gestellt durch den westlichen Militärbezirk):
- 6. und 20. kombinierte Armee;
- 1. Gardepanzerarmee.
Kräftegruppierung „Donbass" (gestellt durch den südlichen Militärbezirk):
- 8. und 49. kombinierte Armee;
- Teile der 150. MotSchützendivision.
Kräftegruppierung „Krim" (gestellt durch den südlichen Militärbezirk):
- 58. kombinierte Armee;
- Teile der 76. Luftlandedivision.
Hinzu kam die Kräftegruppierung „Brest" mit jeweils brigadestarken Kräften der 5. und 29. kombinierten Armee. Beim Einmarsch bestand eine kombinierte Armee in der Regel aus zwei bis vier Brigaden. Dabei handelte es sich hauptsächlich um mechanisierte Infanteriebrigaden, in seltenen Fällen um Panzerbrigaden. Hinzu kamen Raketen-, Artillerie-, Flugabwehr-, Pionier-, Aufklärungs-, ABC-, Elektronische Kampfführung (EloKa)- und Fernmelde- sowie Logistikeinheiten. Hier war nicht immer genügend Gerät vorhanden. So wurden den Verbänden oft nur einzelne TOS-1-Raketenwerfer zugeteilt, aber nicht ganze Batterien. Eine Brigade bzw. ein Regiment bildeten bis zu zwei BTGs. Eine kombinierte Armee verfügte über durchschnittlich acht bis zehn BTGs. Eine Besonderheit stellte die 1. Gardepanzerarmee dar. Diese besteht aus der 2. MotSchützendivision, der 4. Panzerdivision, der 47. Gardepanzerdivision und der 27. MotSchützenbrigade. Ihre Verbände bildeten knapp zwanzig BTGs.
In den ersten Tagen ging der russische Vormarsch zügig voran. Anders als beim russischen Angriff im August 2014 versuchten die ukrainischen Streitkräfte nicht, die russischen Kräfte in Grenznähe aufzuhalten, hatte dies 2014 doch zu den bereits erwähnten massiven ukrainischen Verlusten beigetragen. Diesmal marschierten die russischen Kräfte ein und wurden von den Ukrainern vorerst nur gering in Verzögerungskämpfen gebunden. Man ließ die russischen Verbände fast eine Woche lang vormarschieren, bis ihre Versorgungslinien überdehnt und ohne Sicherung verletzlich wurden. Gezielte Brückensprengungen bewirkten weitere Verzögerungen. Dann schlugen die ukrainischen Spezialeinsatzkräfte und Einheiten der Nationalgarde zu. Sie zerstörten in dutzenden Hinterhalten und im Zusammenwirken mit bewaffneten Drohnen die im Anmarsch befindlichen russischen Versorgungskonvois. Hinzu kam der dezentrale Einsatz der eigenen Artillerie, kombiniert mit einem zeit- und raumoptimierten System der Feueranforderung (Softwareanwendung „GIS Arta" bzw. „Karpiva"). Als nach fünf Tagen die russischen Kräfte zur Auffrischung eine erste operative Pause einlegten, stellten sie fest, dass sie von der Versorgung abgeschnitten worden waren. Es mussten nun Kräfte zur Sicherung eingesetzt werden. Diese Kräfte fehlten ab diesem Zeitpunkt in den Verbänden an den Fronten.
Hier zeigten sich schnell die Grenzen der russischen BTGs. In der Not gab die russische Seite einzelne Waffensysteme (z. B. ganze Batterien der Fliegerabwehr) auf und nahm den Treibstoff aus den aufgegebenen Fahrzeugen oder plünderte ukrainische Tankstellen, um weiter vorankommen zu können. Dies war vor allem im Norden und Nordosten der Fall. Im flachen Gelände des Südens ging der Vormarsch weiter zügig voran. Mariupol wurde am Ende der ersten Woche eingeschlossen. Die ersten Kriegswochen waren jedoch gekennzeichnet von Erfolgsmeldungen auf Seite der Ukraine. Bilder von brennenden russischen Panzern und Schützenpanzern und von erfolgreichen Angriffen auf Versorgungs- und Nachschubkonvois der russischen Streitkräfte dominierten in den Medien. Vor allem der geringe Anteil an infanteristischen Kräften führte nun zu großen Ausfällen innerhalb der russischen BTGs. Es wurde zunehmend offensichtlich, dass die Gliederung der BTGs – 2014 Erfolgsgarant – nicht in der Lage war, die geforderten Gefechtsaufgaben erfolgreich abzuschließen.
Nach ersten Erfolgen und mit zunehmendem Eintreffen von Aufklärungsdaten und Waffenlieferungen durch die USA und NATO gingen die ukrainischen Streitkräfte erstmals in die Offensive über. Die Ausfälle in den russischen Führungskadern begannen zu steigen. Es gelang den ukrainischen Streitkräften, den umfassenden Angriff der russischen Truppen entscheidend zu verzögern und im Raum Kyjiw, Chernihiw und Sumy, im Norden und Nordosten der Ukraine, sogar nachhaltig abzuwehren. Am Ende der sechsten Woche kam es daher zu einem Strategiewechsel in der russischen Einsatzführung. Nach mehreren Wochen des Einsatzes war klar, dass das geplante „tiefe Gefecht" der russischen Streitkräfte gescheitert war. Der Angriff von fünf Kräftegruppierungen an vier Fronten hatte nicht funktioniert. Die Belagerung von Kyjiw musste am West- und Ostufer des Dnipro nach knapp vierzig Tagen aufgegeben werden. Auch Charkiw, ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt und bedeutendes Operationsziel (ausgedrückt durch den Ansatz der russischen 1. Gardepanzerarmee), hielt den Angriffen stand. Mithilfe von Kampfflugzeugen, Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen zerstörten die russischen Streitkräfte zwar weiterhin gezielt Waffenlager, Artillerie und Kommunikationsknotenpunkte in der Ukraine, doch am Boden geriet die Offensive ins Stocken.
Als erreichbares Ziel legte die russische Führung nun einen Angriff auf den Donbas fest. Durch eine neue Schwergewichtsbildung sollte die „Spezialoperation" erfolgreich weitergeführt werden. Die russischen Truppen versuchten daher ab der sechsten Kriegswoche, das zentrale Gewicht in den Donbas zu verlegen, um in einer neuen Kriegsphase durch Einkesselung der dortigen starken ukrainischen Kräfte eine vorläufige Entscheidung zu bewirken. Innerhalb von zehn Tagen wurden ab der siebten Woche die Truppen der beiden nördlichen Kräftegruppierungen (insgesamt vier kombinierte Armeen und Luftlandeverbände mit zu diesem Zeitpunkt noch 40.000 bis 50.000 Soldaten) per Eisenbahntransport in den knapp 1.000 km entfernten Donbas verlegt und umgruppiert. Nach dem Rückzug der russischen Kräfte bis Anfang April nach Belarus und Russland konnte die Ukraine das West- und Ostufer des Dnipro bei Kyjiw bis zur belarussischen Grenze wieder in Besitz nehmen und feierte dies als großen Erfolg. Inzwischen bereiteten sich die russischen Truppen Donbas im auf die nächste Phase vor.
Im Donbas sollten die russischen Streitkräfte nun versuchen, an der seit Minsk I und II bestehenden Kontaktlinie durch Einkesselung der ukrainischen Streitkräfte eine regionale Entscheidung zu erzwingen. Durch gezielte Vorstöße aus den Räumen Isjum und Wolnowacha sollte mit einer Nord- und Südumfassung ein Kessel gebildet werden. Ab der neunten Woche begannen die russischen Kräfte daher im Donbass mit dem Angriff in einer Zangenbewegung aus dem Norden (südlich Isjum) und Süden (südwestlich Donezk). Der Ansatz erfolgte nun langsam, breit und mit massiver Artillerieunterstützung. Dazu wurden die eingesetzten russischen Kräfte völlig neu gegliedert. Zwei bis drei BTG wurden in Regimentskampfgruppen zusammengefasst. Damit hatte man die ursprüngliche Gliederung der BTGs verworfen. Die neu gebildeten Regimentskampfgruppen bildeten je nach taktischer Aufgabe vornehmlich kompaniestarke Kampfgruppen, die je nach taktischem Auftrag von Artillerie und Luftmitteln unterstützt wurden. Zu diesem Zweck gliederte man die artilleristische Kampfunterstützung aus, fasste sie in eigenen Gruppierungen zusammen und führte weitere Artillerie aus Russland heran. Hinzu kamen kampfstarke Verbände der Söldnergruppe „Wagner."
Wo immer durch den Einsatz massierter Artillerie Lücken im ukrainischen Kräftedispositiv entstanden, versucht man, in Kompanie- oder Zugstärke vorzustoßen. Selten waren dabei mehr als drei bis sechs Panzer (v. a. T72B3 oder T72BM) und Kampfschützenpanzer (v. a. BMP, MTLB oder auch BTR82A) im Einsatz. Die ursprüngliche Idee des BTG-Einsatzes war also kaum noch zu erkennen. Die Regimentsebene fungierte fortan vor allem als koordinierende Befehlsebene. Auf operativer Ebene wurde die Gesamtführung an zwei Militärbezirke übergeben. Somit standen der Raum Charkiw bis Donbas und der Raum Cherson bis Mariupol Nord jeweils unter einem Kommando. Da bereits im Donbas im Einsatz, übernahm der südliche Militärbezirk das Gesamtkommando über den Raum Donbas bis Charkiw. Dem westlichen Militärbezirk wiederum wurde die Gesamtverantwortung für den Raum Cherson bis Mariupol Nord zugewiesen. Der russische Vormarsch erfolgte langsam (mit maximal ca. 1,5 Kilometer Tagesleistung), in Gefechtsform, mit Infanterieunterstützung und umfangreichem Artillerievorbereitungsfeuer. In der Regel kämpften die russischen Verbände für knapp fünf Tage, um dann ausgewechselt zu werden. Die Rotation und der Angriffsbeginn wurden von massivem Artilleriefeuer begleitet. Auch während des Vormarsches wurde jeder erkannte Widerstand vorrangig mit Artilleriefeuer niedergekämpft. Das Ziel einer Umfassung wurde räumlich kürzer gesteckt.
Bis zur zwölften Woche gewannen die russischen Zangenbewegungen kaum Raum, trotzdem konnten Tag für Tag stetig kleine Geländegewinne erreicht werden. Entlang des Flusses Donezk tobten heftige Gefechte. Mithilfe von Pontonbrücken versuchten beide Seiten immer wieder, sich an unerwarteter Stelle zu umfassen. In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2022 zeigte diese neue traditionelle Operationsführung schließlich Erfolg. Bei Popasnaya gelang den russischen Kräften der vorerst entscheidende Durchbruch durch die erste Verteidigungslinie. Mitte Mai konnte schließlich ein Kessel im Ausmaß von 40 mal 40 Kilometern gebildet werden. Dieser wurde am Westrand auf eine Enge von zwanzig Kilometern eingedrückt und somit operativ geschlossen, denn die ukrainischen Versorgungslinien befanden sich nun unter Kontrolle des russischen Artilleriefeuers. Um den heftigen russischen Angriffen im Donbas zu begegnen, versuchte die ukrainische Seite die russischen Kräfte an ungünstiger Stelle zu treffen. Dazu starteten sie im April und Mai 2022 im Raum nördlich und nordostwärts von Charkiw sowie bei Cherson erste lokal begrenzte Gegenoffensiven. Doch konnten die russischen Kräfte alle Angriffe abwehren. Auch dabei gingen sie kräfteschonend vor und oft auf verteidigungsgünstiges Gelände zurück.
Ab Ende August 2022 konnten die ukrainischen Streitkräfte dank der Offensiven in Cherson und Charkiw weitere nachhaltige Erfolge gegen die russischen Truppen erzielen. Um zu verstehen, wie das trotz der vermeintlichen Übermacht der russischen Truppen möglich war, muss man beide ukrainische Offensiven näher betrachten und analysieren. Als Ausgangspunkt dienen die vier Faktoren Gelände, eingesetzte Kräfte, Zeit und Information.
Die ukrainische Offensive im Raum Cherson im Süden der Ukraine begann am 29. August 2022 und die wechselvollen Kämpfe dauerten bis zur Aufgabe des Brückenkopfes durch die russische Seite an.
Faktor Gelände: Die russischen Streitkräfte konnten bereits zu Kriegsbeginn das Westufer des Dnipro in Besitz nehmen. Dort hielten sie einen Brückenkopf, der sich von der Dnipro-Mündung im Südwesten über die Stadt Cherson bis in den Nordosten zog. Im Juli und August 2022 gelang es den Ukrainern, Kräfte bereitzustellen und so die Voraussetzungen für eine Offensive zu schaffen. Die Vorbereitungsphase war vor allem vom Versuch geprägt, den russischen Brückenkopf zu isolieren. Ziel war es, die drei wesentlichen Übergangsstellen über den Dnipro – eine Brücke bei Cherson, eine Eisenbahnbrücke in deren Nähe sowie eine weitere Brücke bei einem Kraftwerk im Osten – zu zerstören. Diese drei Brücken stellten Nadelöhre für die Versorgung der russischen Truppen dar. Nach diesem Shaping, so die Absicht der Ukrainer, sollten die russischen Streitkräfte mit zwei Angriffen im Norden und Süden gebunden und anschließend mit einem zentralen Stoß zwei Kessel zwischen dem Dnipro und den ukrainischen Streitkräften gebildet werden, um danach einen Kessel nach dem anderen zu zerschlagen.
Faktor Kraft: Die vom Westen gelieferten Waffensysteme waren eine wesentliche Voraussetzung für einen möglichen Erfolg der Offensive. Besonders zu erwähnen sind die gelieferten Panzer vom Typ T72 aus Polen und Tschechien, aber auch Schützenpanzer vom Typ BMP. Diese bildeten die Speerspitze der Angriffe. Das Mehrfachraketenwerfer-System HIMARS erwies sich bei der Zerstörung der Brücken ebenfalls als effektiv. Auch der Einsatz von mobiler Artillerie, wie das polnische System KRAB, war von wesentlicher Bedeutung. Die Angriffe selbst erfolgten durch drei mechanisierte Kampfgruppen und vor allem mobile Einheiten, die es den Ukrainern nach einem Durchbruch ermöglichen sollten, rasch Geländeteile in Besitz zu nehmen. Am Beispiel von HIMARS zeigt sich die Wirkung westlicher Waffensysteme. Bisher wurden zwanzig Stück Mehrfachraketenwerfer-Systeme an die Ukraine geliefert, die damit im Sommer 2022 mehr als 400 russische Ziele angriffen. Dies traf vor allem die Logistik der russischen Truppen, weil unter anderem wichtige Munitionslager und Stützpunkte zerstört wurden.
Faktor Zeit: Die russischen Streitkräfte setzten zur Aufklärung der ukrainischen Bereitstellungen Drohnen ein. Das stellte die Ukrainer vor die Herausforderung, ihre Kräfte im offenen Gelände bereitzustellen, ohne sogleich zum Ziel von Beschuss zu werden. Das flache Gelände ließ kaum Deckungsmöglichkeiten zu. Videos und Bildmaterial zeigen, wie die russische Seite mit Artillerie immer wieder gezielt die wenigen Heckenstreifen beschoss, in denen ukrainische Verbände Schutz gesucht hatten. Auch vom Beginn der Offensive gibt es Fotos, auf denen man die vorrückenden ukrainischen Verbände im offenen Gelände und das Einschlagen der Granaten der russischen Artillerie erkennen kann. Erst Anfang Oktober verbesserte sich die Situation für die vorstoßenden ukrainischen Truppen. Nach entsprechender Aufklärung gelang es, ausgedünnte Stellen in der russischen Frontlinie zu erkennen und zu durchbrechen. Das zwang die russischen Truppen, sich auf vorbereitete Stellungen und Stützpunkte in der Tiefe (Linie Ischenka–Dudchany) zurückzuziehen. Schließlich wichen sie zur Gänze an das Südufer des Dnjipro zurück.
Faktor Information: Die Offensive begann am 29. August 2022 an drei Stellen. Einerseits mit Bindungsangriffen im Südwesten und im Nordosten sowie mit dem Versuch eines zentralen Vorstoßes inklusive eines Brücken- bzw. Flussübergangs in der Mitte. Dort wollte man nach Zerstörung der Brücken in der vorbereitenden Phase zwei Kessel bilden. Aufgrund des guten Lagebilds war es den russischen Truppen möglich, die ukrainischen Angriffsspitzen rasch mit Gegenangriffen, Artillerie und dem Einsatz von Kampfhubschraubern abzunutzen. Zudem hatten sich die russischen Truppen im Verlauf der Monate vor allem in der Tiefe in vorbereiteten Stellungen eingegraben und tausende von Minen verlegt. Die ukrainische Seite versuchte ab Oktober, durch massierten Artillerieeinsatz eine Entscheidung zu erzwingen. Ein klarer Indikator war der Schwergewichtseinsatz von aus den USA gelieferten HIMARS Raketenwerfern mit M30A1 Geschossen (mit Flächensplitterwirkung gegen Truppenansammlungen und Verteidigungsstellungen). Erst der Abzug der russischen Truppen machte schließlich ein Nachrücken möglich. Der Abzug kam für viele Beobachter überraschend und es spricht vieles dafür, dass er das Ergebnis einer gezielten Vermittlung im Hintergrund war.
Die ukrainische Offensive im Raum Charkiw begann am 6. September 2022 und erzielte tatsächlich einen durchschlagenden, messbaren Erfolg. Auch dieser Erfolg lässt sich mittels der Analyse der Faktoren Gelände, Kraft, Zeit und Informationslage erklären.
Faktor Gelände: Im Raum der zweiten Offensive versuchten die russischen Streitkräfte, nach dem Erfolg der Kesselschlacht von Lyssytschansk weiter Richtung Westen anzugreifen. Dafür stellten sie zusätzlich das dritte Armeekorps auf. Angenommene Absicht war es, aus dem Raum Isjum in den Süden vorzustoßen und damit die Situation im Donbas mit einem Schlag für Russland zu entscheiden. Bereits seit Juli gab es immer wieder Hinweise, dass sich die ukrainischen Streitkräfte im Raum Charkiw positionieren würden, um diesen Plan zu verhindern. Tatsächlich schafften es die Ukrainer, unter höchster Geheimhaltung dort Kräfte bereitzustellen. Ihr Plan sah den weiteren Vorstoß in Richtung Osten bis an den Fluss Oskil vor, um so diesen Raum in Besitz nehmen und die russischen Streitkräfte bei Isjum einkesseln zu können.
Faktor Kraft: Auch bei dieser zweiten Offensive war westliches Militärmaterial entscheidend für den Erfolg. Einerseits spielten erneut Panzer vom Typ T72 aus Polen und Tschechien eine große Rolle, aber auch Schützenpanzer vom Typ M113. Außerdem wurden auch Mehrfachraketenwerfer vom Typ MLRS eingesetzt (Mehrfach-raketenwerfer-Systeme auf Ketten). Zum Einsatz gelangte zudem die Panzerhaubitze 2000, die sich für den Verschuss endphasengesteuerter Munition vom Typ Excalibur eignet. Hochmobile Einheiten, zum Teil auf Pickups oder gepanzerten Fahrzeugen (z. B. Bushmaster), hatten gleichfalls zentrale Bedeutung. Dass die Moral der ukrainischen Soldaten dieser Angriffsgruppierung sehr hoch war, zeigt ein unmittelbar vor Beginn der Gefechte aufgenommenes Video, auf dem sich ukrainische Soldaten nochmals versammeln und ihre Nationalhymne singen. Der Einsatz spezieller Waffensysteme trug ebenfalls zum Gelingen dieser Offensive bei. Das gilt für die bereits genannte endphasengesteuerte und höchst zielgenaue Artilleriemunition vom Typ Excalibur. Ein anderes wirkungsvolles Waffensystem ist die Anti-Radar-Rakete vom Typ AGM-88 aus den USA. Mit dieser gelang es der Ukraine, gezielt russische Fliegerabwehrsysteme zu zerstören und den eigenen Vormarsch sowie den Einsatz der eigenen Luftwaffe – wenn auch in geringem Umfang – durchzusetzen.
Faktor Zeit: Die Offensive begann am 6. September 2022 und fasste Fuß an einer günstigen Stelle, an der eher untergeordnete russische Einheiten im Einsatz waren. Eine gemischte Kampfgruppe konnte mit Panzern vorausfahrend einen zentralen Durchbruch erzielen. Dieser Vorstoß entwickelte sich rasch und wurde zentral in Richtung Osten weiter vorangetrieben. Schließlich war es möglich, eine Distanz von mehr als 50 Kilometer in kurzer Zeit zu überbrücken. Dank dieses Durchbruchs konnten hochmobile ukrainische Einheiten zügig Ortschaften in Besitz nehmen, die ukrainische Flagge hissen und Bilder davon in den sozialen Netzwerken teilen. Damit gewannen die russischen Soldaten den Eindruck, zunehmend umfasst und eingekesselt zu werden, sodass sie schließlich die Flucht in Richtung Osten antraten. Und wie die Militärgeschichte zeigt, so war es auch nicht hier mehr möglich, eine große Armeeformation aufzuhalten, sobald diese einmal begonnen hat, sich fluchtartig abzusetzen. Die Russen taten zu diesem Zeitpunkt das einzig Mögliche: Sie versuchten, eine Verteidigungsstellung am Fluss Oskil einzurichten und dort die zurückflutenden Verbände aufzunehmen. Wie prekär die Situation war, zeigen mehrere Videos, auf denen russische Soldaten mit schweren Hubschraubern vom Typ MI-26 bis in die Nacht hinein Panzer anlanden, um diese Linie zu verstärken. Die russischen Truppen ließen schließlich viel schweres Gerät (man nimmt an, die Ausstattung von drei Panzerregimentern) zurück, weil sie sich überstürzt nur mit leichten Fahrzeugen Richtung Osten oder Richtung Süden bzw. Richtung Isjum abgesetzt hatten.
Faktor Information: Der ukrainische Angriff wurde im Kern von zwei mechanisierten Brigaden, einer Luftsturmbrigade, territorialen Einheiten und zusätzlichen Elementen zur Unterstützung durchgeführt. Die ukrainischen Streitkräfte stießen rasch vor und schafften es, den Angriff Richtung Osten weiter voranzutreiben. Die russische Seite vermochte diesen Angriffsschwung nicht zu brechen und wurde daher von den Ereignissen überrollt.
Bei der Analyse dieser Offensive kann man historische Vergleiche heranziehen. Ein Beispiel wäre das Unternehmen Cobra im Juli 1944: der Durchbruch der alliierten Streitkräfte aus dem Brückenkopf in der Normandie in die Tiefe des französischen Tieflands. Durch Einsatz von zwei Panzerdivisionen konnten die Alliierten rasch in die Tiefe stoßen und die Voraussetzungen für den Kessel von Falaise schaffen. Die deutschen Streitkräfte mussten fluchtartig aus diesem Kessel ausbrechen und eine hohe Anzahl an Waffen, Ausstattung und Gerät zurücklassen. Das Unternehmen Bagration im Juni 1944 eignet sich ebenso für einen Vergleich. Durch einen massiven Angriff gelang es damals, nicht bloß die russische Seite voranzutreiben, sondern vor allem die deutschen Truppen zu einer Fluchtbewegung zu zwingen, die bis fast zur Grenze des Deutschen Reiches nicht mehr nachhaltig zu stoppen war. Auch das ist in der Ukraine theoretisch möglich. Ebenso möglich ist es, dass der Erfolg nur von kurzer Dauer ist, vergleichbar mit der deutschen Ardennen-Offensive im Dezember 1944. In jenem Fall gelang zwar der Vorstoß, aufgrund der Überlegenheit des Gegners war man jedoch gezwungen, das gewonnene Gelände wieder aufzugeben. Möglicherweise führen die Erfolge der ukrainischen Streitkräfte aber dazu, dass es zu Umbrüchen in Russland kommt, ähnlich wie im Oktober 1917. Momentan gibt es zwar keine Indikatoren dafür, aber es könnte durchaus sein, dass es nach weiteren schweren Niederlagen zu Zerfallserscheinungen kommt.
Beim russischen Vormarsch im Februar 2022 machten sich rasch die Grenzen der BTG-Struktur bemerkbar. Der Mangel an massierter Infanterie und die dezentrale, vor allem auf operativer Ebene vorherrschende Führungsstruktur wirkten sich nachteilig aus. Es erwies sich, dass der anfängliche russische Kräfteansatz von 180.00 bis 200.000 Soldaten, die zunehmend abgenützt wurden, zu gering eingeschätzt worden war. Der Beginn der russischen Offensive im Donbas zeigt ebenfalls, dass die russischen Streitkräfte weiterhin überzeugt waren und sind, eine Entscheidung zu ihren Gunsten auf dem Gefechtsfeld zu erreichen. Der Wechsel zur langsamen und traditionellen russischen Gefechtstechnik und Taktik trug die Handschrift erfahrener Kommandeure und ließ erkennen, dass die russischen Kräfte in der Lage sind, sich auf die Taktik der ukrainischen Kräfte einzustellen. Die russischen Streitkräfte haben jedoch bereits hohe Verluste erlitten und sind an vier Fronten (Charkiw, Donbas, Saporoschija und Cherson) gefordert. Ein noch immer möglicher Erfolg der russischen Seite wird davon abhängen, ob sie in der Lage ist, laufend eigene Kräfte und Reserven nachzuführen und im Gegenzug die ukrainische Versorgung in der Tiefe abzuschneiden Für die ukrainischen Streitkräfte besteht hingegen seit dem 24. Februar 2022 die Herausforderung eines Abnützungskrieges. Eine große ukrainische Offensive erscheint, massive westliche Militärhilfen vorausgesetzt, erst mittelfristig möglich. Ziel des Westens wird es mittelfristig sein, die russischen Reserven abzunützen.
Russland beherrscht nach wie vor die Krim und den Oblast Luhansk sowie zu einem hohen Anteil Cherson und Saporoschija. Auch in Donezk gelingt es den russischen Truppen nach wie vor, langsam vorzumarschieren. Hier sind knapp über 50 Prozent besetzt. Entscheidende Vorstöße der Ukrainer sind bei Charkiw und Cherson zu verzeichnen. Damit verringerte sich das von Russland besetzte Gelände weiter, derzeit auf ca. 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets. Nach der erfolgreichen Durchführung dieser ukrainischen Offensiven, geht der Konflikt nun in eine neue Phase. Die erste Phase bestand in Angriff und Abwehr der russischen Streitkräfte im Raum Kyjiw, die zweite aus dem Übergehen der Handlungsinitiative an Russland und den Angriffen im Donbas mit der Kesselschlacht von Lyssytschansk. Die dritte Phase ist durch die Offensiven bei Cherson bzw. Charkiw vom Übergehen der Initiative auf die ukrainische Seite gekennzeichnet. Zurzeit ist erkennbar, dass der Erfolg von Charkiw für weitere ukrainische Angriffe im Raum Lyman bzw. über den Fluss Oskil genutzt werden soll. Dabei kann erneut eine Einkesselung gelingen. Doch südostwärts von Lyman rücken die Russen weiterhin langsam in Richtung Westen vor mit dem Ziel der gänzlichen Einnahme des Oblasts Donezk.
Wie die taktisch/operativen Erfolge im Raum Charkiw und Cherson zeigen, waren die Ukrainer in der vierten Phase in der Lage, nach Zusammenziehen der Kräfte und entsprechender Geheimhaltung eine Offensive durchzuführen und die „russische Dampfwalze" zu stoppen. Auch lassen die Offensiven erkennen, dass westliche Waffenlieferungen das Gefechtsfeld entscheidend beeinflussen können. Alles hängt jetzt davon ab, ob die ukrainischen Streitkräfte ihren Erfolg weiter ausbauen können. Das Ergebnis wird man in den nächsten Monaten sehen. Auch die Auswirkungen der russischen Mobilisierung und der laufenden strategischen Abnützung (Angriffe mittels ballistischer Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen, derzeitige fünfte Phase) können den Ausgang beeinflussen. Erst im Frühjahr wird sich daher zeigen, ob in diesem Krieg eine Wende tatsächlich möglich ist.
Durch den Misserfolg des Einmarsches im Februar 2022 waren die russischen Landstreitkräfte gezwungen ihre Gefechtstechnik und Taktik an die neue Einsatzführung anzupassen. Die Gliederung der BTG wurde dabei angepasst oder gar verworfen. Die meisten BTGs sind derzeit in andere Einheiten überführt worden und spielen offenkundig keine Rolle mehr in den russischen Kriegsplanungen. Den größten Nachteil der BTGs stellte der Mangel an verfügbarer Infanterie dar. Diese ist aber notwendig, um die vormarschierenden mechanisierten Kräfte begleiten und schützen zu können. Das gilt vor allem für den urbanen Raum, wie die schweren Häuserkämpfe in Mariupol, Popasna, Marinka und Bakhmut gut erkennen lassen. Diese Herausforderung versuchen die russischen Streitkräfte durch laufendes Heranführen von mobilisierten Soldaten zu meistern. Während sie im Moment auf operativer Ebene in der Defensive sind, versucht die ukrainische Seite, den durch die Offensiven bei Charkiw und Cherson gewonnenen Vorsprung beizubehalten. Aus ukrainischer Sicht bieten sich hier zwei operative Ansätze an. Ein Vorstoß ostwärts von Charkiw in Richtung Kremenna und Lyman oder ein Vorstoß aus dem Raum Saporischschja ostwärts des Dnjipro-Knies in Richtung Melitopol und Asowsches Meer. Ein Vorstoß aus dem Gebiet Kreminna würde das russische Kräftedispositiv im Donbas von einigen seiner wichtigsten Versorgungslinien abschneiden. Noch verheerender wäre jedoch der Stoß über Melitopol zum Asowschen Meer. In Kombination mit einem neuerlichen Angriff auf die Brücke über die Straße von Kertsch wären die russischen Truppen in Cherson, Saporischschja und auf der Krim mit einem Schlag von jeder Landverbindung und somit Versorgung abgeschnitten. Ein überaus verlockendes Ziel für die ukrainischen Streitkräfte, verknüpft mit strategischen Folgen. Die Verlegung von Truppen in die Räume westlich Kreminna und nach Saporischschja legt nahe, dass das ukrainische Oberkommando diese Optionen derzeit erwägt. Ukrainische Sondierungsangriffe und der Einsatz von weitreichender Artillerie lassen sich als erste Vorbereitungsmaßnahmen deuten.
By Markus Reisner PhD and Christian Hahn MSD MA
Reported by Author; Author
Kommandant der Garde
Hauptlehroffizier Taktik & HLO Versorgung