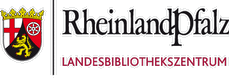Die europäische Friedensordnung liegt in Trümmern. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist in Zielen und Mitteln ein Zivilisationsbruch, der die internationale Politik auf vielen Ebenen verändert hat und weiter verändern wird. Das ist nicht nur eines der prägendsten Ereignisse der internationalen Sicherheitspolitik der vergangenen 30 Jahre, sondern stellt auch die theoretische Beschäftigung mit internationaler Politik vor eine Bewährungsprobe. Theoriefragen werden zwar innerhalb der Sozialwissenschaften intensiv diskutiert, sind jedoch oftmals von praktischen Debatten abgekoppelt und bewegen sich häufig in einem elfenbeinturmartigen Diskursraum. Dies gilt ebenso für die Sicherheitspolitik, obschon bei ihr traditionell sowohl theoriegeleitete als auch praxisorientierte Ansätze eine Rolle spielen.
Was kann die theoriegeleitete Beschäftigung mit internationaler Sicherheitspolitik leisten? Karl Popper sah Theorien als Netze, die wir auswerfen, um die Welt einzufangen, zu rationalisieren und zu erklären. Das Auswerfen eines Netzes löst noch keine Probleme, ist aber womöglich Voraussetzung dafür, die „richtigen" Probleme zu erkennen und Handlungsoptionen zu entwickeln. Politische Entscheidungsträger können gewiss ohne Theorie auskommen – und auch die Beschäftigung mit Sicherheitspolitik ist theoriefrei möglich. Allerdings werden Begriffe und Konzepte mit theoretischem Zugriff eher greifbar und sortierter als bei Analysen, die nicht die ihnen – implizit oder explizit – zugrundeliegenden theoretischen Annahmen betrachten.
Mit Blick auf den Ukraine-Krieg kann die Theorie der internationalen Beziehungen (IB-Theorie) durchaus helfen zu erklären, was geschehen ist, auf verpasste Chancen und Probleme aufmerksam zu machen und daraus abgeleitet Handlungsoptionen vorzuschlagen. Dabei kommen naturgemäß sehr unterschiedliche Sichtweisen und großtheoretische Denkschulen – verstanden als weltbildartige Konstrukte, die den Charakter des internationalen Milieus erfassen – infrage. Die eine Theorie, die für alles passt, gibt es selbstverständlich nicht. Vielmehr haben sich im Lauf der Zeit einige große Stränge (im Wesentlichen Realismus/Neorealismus, Liberalismus, Institutionalismus und Konstruktivismus) herausgebildet, die im Sinn eines Theorienpluralismus nebeneinander bestehen und zum Teil komplementär, zum Teil konkurrierend Erklärungskraft beanspruchen.
Zu diesen Analyseangeboten zählt die realistische Schule, die freilich sehr unterschiedliche Ausprägungen hervorgebracht hat. Der klassische Realismus nach Hans Joachim Morgenthau nahm an, die Anarchie im internationalen System führe systemisch zu einer existenziellen Unsicherheit. Er sieht Staaten als zentrale Akteure und blendet deren interne Verfasstheit eher aus. Zudem betont er bei einem skeptisch-negativen Menschenbild Kategorien wie Macht, Machtmaximierung und materielle Faktoren. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz modifizierte den klassischen Realismus, indem er die Struktur des internationalen Systems in den Mittelpunkt rückte und das Streben nach Macht durch das Trachten nach Sicherheit ersetzte. Daneben haben sich weitere Formen entwickelt, darunter der „Post-Klassische Realismus", der zusätzliche Variablen wie solche innenpolitischer Art integriert.
Realisten gleich welcher Schattierung sehen im russischen Angriff auf die Ukraine einen Beleg dafür, dass Großmächte sich mitunter nach eigener Interessenabwägung regelwidrig verhalten und Völkerrecht brechen, wenn ihre selbst definierten Sicherheitsinteressen auf dem Spiel stehen. „That lesson doesn't justify such behavior, but realists recognize that moral condemnation alone won't prevent it." Der oft damit einhergehende rigide moralische Relativismus stößt selbstverständlich häufig auf Kritik, so jüngst bei Matthew Spencer, der realistischen Denkern eine Nähe zum Imperialismus des 19. Jahrhunderts attestiert und sie in eine Linie klassischer geopolitischer Vorstellungen von Friedrich Ratzel, Karl Haushofer und Carl Schmitt stellt.
„Few politicians articulate and robustly defend political realism in public (...) though many may hold such views in private." Das lässt sich auch im Fall Ukraine sagen. In einer praxisnahen Variante haben insbesondere Publizisten und ehemalige Praktiker realistische Gedanken populär gemacht. So stellt der Publizist Robert Kaplan ein „realistisches Glaubensbekenntnis" auf. Er konstatiert: (
Eine besonders einschlägige Konkretisierung (neo-)realistischer Weltbilder stellt der sogenannte „Offensive Realismus" nach John Mearsheimer dar. Auch ist er ein Beispiel für eine theoriegeleitete Herangehensweise mit dem Ziel, aktuelle Fragen der internationalen Sicherheitspolitik zu bewerten und Handlungsempfehlungen an die Politik zu formulieren. Ob das trägt, wird höchst strittig debattiert.
Kern von Mearsheimers 2001 umfassend in dem Band „The Tragedy of Great Power Politics" dargelegter Theorie ist, aufbauend auf den Arbeiten von Morgenthau und Waltz, die These, Staaten strebten grundsätzlich nach einer (zumindest regional) hegemonialen Position und Machtmaximierung, weshalb unter den Bedingungen einer unbalancierten Multipolarität neue Kriege zwischen Großmächten zu erwarten seien. Basierend auf fünf Annahmen (1. Anarchieproblematik, 2. offensives militärisches Machtpotenzial von Großmächten, 3. Ungewissheit bzw. Kontroverse in der Frage, ob sich andere Staaten aggressiv verhalten könnten, 4. oberstes staatliches Ziel ist das Überleben, 5. Staaten verhalten sich rational im Sinn dieses Ziels) leitet diese Theorie aus einer historischen Betrachtung heraus strukturelle Akteurskonstellationen ab und bewertet sie.
Insgesamt, so die Argumentation, seien die Anreize stark, dass Großmächte in Bezug auf andere offensiv denken und handeln. Damit lägen drei allgemeine staatliche Verhaltensmuster vor: Angst, Selbsthilfe und Machtmaximierung. Insbesondere die Struktur des internationalen Systems und nicht die besonderen Eigenschaften einzelner Großmächte veranlasse diese dazu, offensiv zu denken. Angesichts der Unsicherheit, welches Maß an Macht heute und morgen genüge, sei Hegemoniestreben für Großmächte unvermeidlich. Staaten seien fast immer gut beraten, mehr statt weniger Macht anzustreben, und würden sich erst dann als Status-quo-Mächte etablieren, wenn sie das System vollständig dominierten. Die Tragik von Großmächten liege jedoch darin, diesen systemischen Wirkungen unwiderruflich und unausweichlich zu unterliegen. Auch wenn Realisten ihre eigene Beschreibung der Gesetzmäßigkeiten internationaler Politik gewiss nicht angenehm finden, weisen sie zugleich auf die Risiken des „when you threaten what another state regards as a vital interest" hin. Denn Theorien seien dann nützlich, wenn sie beschreiben, wie sich Großmächte normalerweise zueinander verhalten, und darauf aufbauend deren zukünftiges Verhalten erklären.
Mearsheimer ist für seine Annahmen und Schlussfolgerungen vielfach kritisiert worden, insbesondere hinsichtlich der Unvermeidbarkeit einer Auseinandersetzung der USA mit dem aufstrebenden China. Seine Theorie hat er in einer Reihe von Arbeiten auch auf die Ukraine und Russland angewendet. Den Anfang machte 1993 ein Artikel, in dem er gegen die Abgabe der ukrainischen Nuklearwaffen an Russland argumentierte, weil dies einen Krieg Russlands gegen die Ukraine wahrscheinlicher mache. 2014 veröffentlichte er einen viel zitierten Beitrag, in dem er Verständnis für vermeintliche russische Einkreisungsängste wegen einer Ausdehnung des Westens unter Führung der USA aufbrachte. Der Dreierpack des Westens aus NATO- und EU-Erweiterung sowie Demokratieförderung, so Mearsheimer, habe ein Feuer genährt, das nur noch auf Entzündung wartete. Die Annexion der Krim durch Russland sei demnach Schuld des Westens gewesen. Diesen Gedanken bekräftigte er in zahlreichen Beiträgen auch nach dem 24.2.2022, die allesamt im Prinzip auf derselben Linie argumentieren.
Eines der Kernargumente Mearsheimers lautet, dass die NATO spätestens 2008 mit dem Beitrittsversprechen an die Ukraine eine rote Linie für Russland überschritten habe. Dies sieht tatsächlich eine Reihe von Praktikern und Analysten so. Dabei geht es weniger um die lang anhaltende Diskussion darüber, ob der Westen gegenüber Russland wortbrüchig geworden sei, weil es verbindliche Zusagen gegeben hatte, die NATO nicht zu erweitern. Im Vordergrund steht vielmehr die Frage, ob es politisch klug war, auf russische Befindlichkeiten – jedenfalls in russischer Perzeption – keine ausreichende Rücksicht zu nehmen. Solche Aussagen reichen vom damaligen US-Botschafter in Moskau, der 2008 die Bedenken Russlands als „both emotional and based on perceived strategic concerns about the impact on Russia's interests in the region" beschrieb, über das Eingeständnis eines ehemaligen US-Verteidigungsministers („our actions have contributed to that hostility") bis hin zur Wertung eines US-amerikanischen Historikers („incorporating Ukraine would be strategic madness"). Unstrittig ist, dass Russland die NATO-Osterweiterung unmissverständlich ablehnte, auch wenn die NATO jede Erweiterungsrunde mit einem aus ihrer Sicht weitgehenden Kooperationsangebot an Moskau verband. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2007 wurde Putin deutlich: Eine weitere Expansion der NATO sei eine schwere Provokation Russlands und man könne nicht unvoreingenommen beobachten, wie die militärische Struktur der Allianz immer näher an die eigenen Grenzen heranrücke. Auch der russische Außenminister Lawrow erklärte bei zahlreichen Gelegenheiten vor und nach Beginn des Angriffskriegs, dass Russland seine roten Linien stets deutlich gemacht und Bereitschaft zu Zugeständnissen und Kompromissen gezeigt habe.
Die innenpolitischen Entwicklungen in der Ukraine im Rahmen der Euromaidan-Proteste und die Entscheidungen des Westens, die Ukraine ab 2006 in die US-geführten Rapid-Trident-Manöver einzubeziehen mit dem Ziel einer schleichenden Annäherung an die NATO, rückten eine russische Gegenreaktion zunehmend in den Bereich des Möglichen. Bereits ab April 2005 nahm die Ukraine am sogenannten „Intensified Dialogue on Membership" teil, der als eine Vorstufe zum „Membership Action Plan" (MAP) konzipiert ist. Auf dem Bukarester Gipfel 2008 kam die Allianz überein, „dass diese Länder (Georgien und Ukraine) NATO-Mitglieder werden." Dem ging allerdings ein heftiger Streit innerhalb der NATO voraus. Insbesondere die USA wollten einen schnellen Beitritt, Deutschland, Frankreich und einige andere Staaten lehnten das aufgrund russischer Bedenken ab. Heraus kam ein Kompromiss, der zwar eine Aufnahme in ferner Zukunft zusichert, die technische Umsetzung – also die Aktivierung des MAP – aber auf einen späteren Zeitpunkt bzw. einen noch zu treffenden Beschluss der NATO-Außenminister vertagt. Die Ukraine wurde damit in eine geopolitische Grauzone geworfen.
Russlands Annexion der Krim und Unterstützung der Separatisten im Donbass im Frühjahr 2014, denen der Sturz des von Moskau gestützten Regimes von Viktor Janukowitsch vorausging, waren deutliche Hinweise, dass Russland gewillt war, mit offener oder/und verdeckter militärischer Gewalt zu reagieren, wenn seine selbst definierte Einflusszone auf dem Spiel steht. Anders als die Mehrzahl der Osteuropa- und Russlandexperten, die auf die zunehmende innenpolitische Radikalisierung in Russland sowie auf dessen zunehmend revisionistische Außenpolitik hinweisen und dies durchaus berechtigt tun, deuten Realisten das russische Vorgehen als Schutz der eigenen (und selbst definierten) Sicherheitsinteressen durch Schaffen und Verteidigung von Einflusssphären. Wer das nicht nachvollziehen könne, missverstehe die wahre Logik der internationalen Beziehungen.
Bis zum Jahr 2021 nahm diese Debatte, begleitet von einer Eskalation der militärischen Auseinandersetzungen im Donbass und groß angelegten russischen sowie, wenngleich deutlich kleineren, westlichen Militärmanövern erneut an Fahrt auf. Die NATO bekräftigte im Juni 2021 auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel ihr Beitrittsversprechen an die Ukraine und im November 2021 kam es zu einem Abkommen zwischen den USA und der Ukraine, dass u. a. die Beitrittszusage erneuerte und eine sehr weitgehende Kooperation zwischen beiden Staaten im Verteidigungsbereich vereinbarte. Der Zug in Richtung NATO-Mitgliedschaft der Ukraine legte also sichtbar Tempo zu – auch wenn dem vielfach entgegengehalten wird, eine tatsächliche Mitgliedschaft hätte nur durch einstimmigen Beschluss des NATO-Rates erfolgen können und sei mithin faktisch sehr unwahrscheinlich gewesen. Ab 2021 spitzte sich die Situation jedoch zu, nachdem die neu ins Amt gekommene Regierung Biden eine Aufnahme der Ukraine in die NATO forcierte, die USA und Großbritannien sich zunehmend in der Ukraine engagierten und zugleich die Regierung Selenskyj eine zunehmend russlandkritische Politik verfolgte.
Die Eskalation der Lage war also mit realistischem Blick absehbar. Der Verfasser dieses Artikels selbst hatte Anfang Dezember 2021 gemeinsam mit zwei Dutzend ehemaligen hohen Militärs, Botschaftern und Wissenschaftlern aus dem „transatlantischen Mainstream" den Aufruf „Raus aus der Eskalationsspirale" veröffentlicht. Dessen Kernpunkte erscheinen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 und nach neun Monaten Krieg aus einer anderen Zeit zu stammen. Die Autoren hatten sich damals angesichts der bereits vorhersehbaren Eskalation der Lage gefragt, ob es bei dem fragilen Status quo im Verhältnis zu Russland bleiben solle oder einen neuen politischen Anlauf brauche, um die brisante Lage zu entschärfen. Der realpolitische Ausgangspunkt der Unterzeichner lautete: Russlands Drohgebärden gegenüber der Ukraine sind inakzeptabel, doch Empörung und formelhafte Verurteilungen führen nicht weiter. Eine vorwiegend auf moralische Empörung und Abschreckung setzende Politik kann im Fall Ukraine nicht erfolgreich sein. Wirtschaftlicher Druck und verschärfte Sanktionen haben Russland bisher nicht zur Umkehr bewegen können. Dies dürfe der Westen nicht als Entschuldigung für tatenloses Zusehen oder Akzeptanz der Eskalation nutzen. Vielmehr solle die NATO proaktiv auf Russland zugehen und auf eine Deeskalation der Situation hinwirken.
Der Aufruf forderte einen vierfachen politischen Ansatz: (
Dieser Aufruf fand vielfältige Resonanz. Zustimmung kam aus dem Lager derer, die stets sehr nah an russischen Positionen waren, Kritik aus dem transatlantischen Mainstream. Spätestens nach Veröffentlichung eines Meinungsbeitrags in der FAZ distanzierten sich einige der Mitunterzeichner von dem Aufruf. Die dortige Argumentation lautet: Man müsse nachdenken, „russische Einflusszonen" zu akzeptieren und der Ukraine eine NATO-Beitrittsperspektive abzusprechen und so die Beschlüsse von Bukarest aus dem Jahr 2008 zu korrigieren. Mit den kurz vor Weihnachten 2021 als Ultimatum vorgelegten Vorschlägen für einen neuen Sicherheitsvertrag war Russlands Sicht klar artikuliert. Darauf blind einzugehen hätte bedeutet, nicht durch diplomatischen Interessenausgleich, sondern durch Androhung militärischer Gewalt ein Europa der Einflusszonen zu akzeptieren und auf die Prinzipien der Charta von Paris aus dem Jahr 1990 zu verzichten. Das hätte kein nachhaltiger Weg sein können. Denn gerade das Prinzip territorialer Integrität ist zweifellos von strategischer Bedeutung für die Stabilität in Europa. Russland darf seine selbst definierten Einflusszonen keinesfalls mit Drohungen und Gewalt endgültig an sich binden, sondern sollte besser mit soft power agieren, also der Attraktivität seines Politik- und Wirtschaftsmodells.
Die russischen Vorschläge komplett zurückzuweisen war genauso falsch. Russland in diesem zentralen Punkt entgegenzukommen und die Beitrittsperspektive der Ukraine zur NATO vorerst auf Eis zu legen – und damit die eigenen Beschlüsse aus dem Jahr 2008 zu revidieren – hätte zwar wichtige Prinzipien verletzt. Doch wenn die Ablehnung erkennbar in einer Eskalationsspirale mündet, aus der es kein Entkommen gibt, dann hätte westliche Diplomatie schmerzhafte Kompromisse schmieden, einen Interessensausgleich vornehmen und versuchen müssen, das Schlimmste zu verhindern.
Zu einer solchen partiellen Infragestellung der eigenen Position waren aber weder die NATO noch die USA bereit. Die offiziellen Antworten der beiden auf die russischen Vorschläge wurden nicht veröffentlicht, doch von einer spanischen Zeitung geleaked. Kern der nahezu gleichlautenden Erklärungen des amerikanischen Außenministers und des NATO-Generalsekretärs war: „We cannot compromise on principles." Gegenüber den russischen Vorschlägen mehr Verhandlungsbereitschaft zu zeigen hätte in realistischer Lesart keineswegs bedeutet, die Ukraine (für die voraussichtlich zudem kaum jemand im Westen mit eigenen Soldaten militärisch kämpfen würde) „im Stich zu lassen." Es hätte bedeutet, mit der Ukraine, mit Russland, den USA und den europäischen Staaten darüber zu verhandeln, welchen Platz die Ukraine und Russland in der europäischen Sicherheitslandschaft einnehmen könnten. Entsprechende Vorstellungen lagen auf dem Tisch, so etwa eine „Finnlandisierung" der Ukraine, also eine wie auch immer ausbuchstabierte Neutralität. Herfried Münkler z. B. meinte vor Kriegsbeginn im Dezember 2021, man solle akzeptieren, „dass es eine Einflusszone Russlands gibt und eine von EU und NATO. Die überlappen einander. Das Ziel bestünde darin, eine stabile Pufferzone herzustellen, zu der ganz sicher die Ukraine und Belarus gehören. Sie stehen zwischen den beiden großen Akteuren. So stoßen die nicht unmittelbar aufeinander. Das liegt doch auch in unserem Interesse." Diesen Gedanken wiederholte er nach Kriegsbeginn. Mit einer „Zone überlappender Interessensphären", so Münkler, hätte der „Waffengang zugunsten von Verhandlungen vermieden werden können."
All dies klang vielen selbst angesichts der russischen Drohgebärden im Frühjahr 2022 (also vor Kriegsbeginn) nach allzu schmutziger Realpolitik. Gefühliges Beklagen entfachte jedoch nicht die notwendige politische Dynamik, um der gefährlichen Eskalationsspirale zu entrinnen. Vielmehr hätte es nach realistischer Betrachtungsweise radikalere Schritte und eine kritische Auseinandersetzung mit den gültigen Prinzipien und Strategien gebraucht, zumal der Westen und die NATO auf Basis der eigenen Stärke bzw. gesicherten Abschreckungsfähigkeit ihres Bündnisgebiets handeln und verhandeln können.
Dies war gleichwohl selbst im Kreis der Unterzeichner des Aufrufs nicht mehrheitsfähig. So schrieb einer von ihnen, der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr Klaus Naumann, in einem Leserbrief an die FAZ, dass er das Bemühen um Dialog zwar verstehe, man aber nun in der Bereitschaft, Russland entgegenzukommen, nicht zu weit gehen dürfe. Partner verhandelten nicht miteinander, wenn einer, in diesem Fall Russland, mit gezogener Waffe eine Unterschrift zu erzwingen versuche. Der Verfasser dieses Artikels entgegnete ihm wie folgt: „Ich habe in dem FAZ-Artikel argumentiert, dass wir keineswegs blind auf die russischen Vorschläge eingehen sollten, diese aber eben auch nicht blind zurückweisen sollten. Vorangestellt hatte ich auch, dass ich das aktuelle russische Verhalten für inakzeptabel halte. Im Kern wollte ich neben diesen Selbstverständlichkeiten einen anderen Gedanken in die Debatte einbringen – und hier ist es möglich, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben: Eine diplomatisch klug gespielte Bereitschaft des Westens, den in Russland wahrgenommenen Zug der Ukraine in die NATO (auch wenn das faktisch heute nicht ansteht) zu stoppen, würde Ausgangspunkt für ernsthafte Verhandlungen sein können. In diesen müsste der Westen seine Kerninteressen wahren, aber es ist auf der Basis eigener Stärke eine Brücke zu dem Russland nötig, wie es derzeit nun mal ist. Ich halte das weiterhin für ein Gebot der nüchternen Realpolitik und insofern trägt das an sich starke Argument, man verhandele nicht mit der Pistole am Kopf, nicht vollständig."
Dieser realistische Weg hat weiterhin seine Richtigkeit. Auch wenn aus heutiger Sicht viel dafür spricht, dass mit Putin kein Interessenausgleich möglich war, so war der Versuch durchaus vernünftig. Der Westen hätte eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine klarer zur Debatte stellen bzw. ausschließen müssen. Zu Versäumnissen kam es auf allen Seiten. Als Ergebnis sehen wir nun ein Versagen der Diplomatie – selbst wenn es ein russisches Drehbuch gegeben haben sollte, das von vornherein feststand, und daher die Annahme naiv gewesen wäre, im Frühjahr 2022 noch Einfluss auf die russische Positionierung nehmen zu können. Zugleich gilt es auch zu erwägen, ob es ein Fenster gab, das einen Interessenausgleich ermöglicht hätte. Es ist anders gekommen und die Historiker werden entscheiden, wer welche Verantwortung trägt. Gewiss sind sicherheitspolitische Identitätsprobleme in der internationalen Politik die gefährlichsten und am schwierigsten zu lösen. Aber unterschiedliche Ordnungsvorstellungen sind in der internationalen Politik eben keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Was gewesen wäre, wenn die USA und wichtige NATO-Staaten im beschriebenen Sinn klüger verhandelt hätten, wissen wir nicht. Als Resultat sehen wir jetzt ein Versagen auf allen Ebenen und sollten den Fehler nicht nur bei der anderen Seite suchen.
Das russische Verhalten erleichtert Selbstkritik nicht gerade, macht sie vielleicht sogar unmöglich. Es stimmt, dass Russlands imperiales Bestreben spätestens ab 2008 erkennbar war. Doch man hätte dieses Bestreben, so die realistische These von Mearsheimer und anderen, besser einhegen müssen. Es wurde zu wenig beachtet, dass die Ukraine für Russland ein Sonderfall und ein Kernthema von vitalem Interesse ist. In realistischer Theorie geschulte Akteure hätten das erkennen können und müssen. Dann hätte es zwei Möglichkeiten gegeben: Entweder hätte man die Ukraine radikal schützen und sofort „ins westliche Camp ziehen" müssen, so wie die USA es 2008 verlangten – also eine NATO-Mitgliedschaft zugestehen und seine Bereitschaft erklären, für die Ukraine zu kämpfen. Das hätte aller Wahrscheinlichkeit nach bereits damals eine militärische Reaktion Russlands und womöglich einen großen Krieg ausgelöst. Die zweite Möglichkeit hätte darin bestanden, eine Pufferzone, d. h. eine neutrale Ukraine, als Schlüssel zur Lösung zu akzeptieren und darüber zu verhandeln. Diesen Weg einer realpolitischen Frontbegradigung auszuloten, dazu waren die USA und ihre westlichen Verbündeten nicht bereit, weil man die Existenz von Einflusszonen tabuisierte und die eigenen Prinzipien als fundamental ansah. Dabei hätte ein nüchternes Ausloten keineswegs bedeutet, ein neues Jalta und die Teilung Europas zu billigen, sondern vielmehr die Anerkennung einer realpolitisch gegebenen Situation: Eine stabile und im Gleichgewicht befindliche Pufferzone zwischen zwei Interessensphären ist allemal besser als eine Dauereskalation mit möglicherweise katastrophalem Ausgang für alle Beteiligten. Genau diese katastrophale Situation ist nun eingetreten und die Selbstgefälligkeit der Debatte kann nur verwundern. Im Grunde ging es um nicht mehr und nicht weniger darum, als „zwischen einer freien Bündniswahl der Ukraine und strategischer Balance und Stabilität in Europa abzuwägen."
Für die Wahl einer Strategie sollte man die eigenen Handlungsmöglichkeiten ebenso rational erkunden wie prüfen, welche Mittel man einzusetzen bereit ist. Wie man es auch dreht und wendet: Die Ukraine befindet sich im russischen Einflussgebiet, solange niemand – aus sehr guten Gründen – gewillt ist, für ihren Beistand in den Krieg gegen Russland zu ziehen bzw. sie schnell in die NATO aufzunehmen und damit einen russischen Angriff als Bündnisfall zu werten. Geht man nicht davon aus, dass Russland bald einen Regimewechsel erlebt oder sich gar von seinem Irrweg abwendet und aus der Ukraine zurückzieht, dann hätte eine Stabilisierung der Lage durch einen – mit möglichst ausgewogenen Sicherheitsgarantien abgesicherten – Neutralitätsstatus sich für alle Seiten als beste Variante erwiesen, letztlich auch für die Ukraine.
Die Bewertung der Lösungsmöglichkeiten dieses Konflikts hängen zentral mit der Einschätzung seiner Ursachen zusammen. Das realistische Analyseangebot ist in diesem Fall ebenso klar wie umstritten. Doch so zu tun, als hätte der eingeschlagene Weg – nach monatelangem Krieg, massiven Verlusten auf beiden Seiten und weitgehender Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur – bisher Erfolg gebracht, ist nicht glaubwürdig.
Die realistische Betrachtung schließt in keiner Weise aus, das alte Konzept des Containments, also der Eindämmung russischer Macht, wiederzubeleben und effektiver zu machen. Das heißt, die Ostflanke der NATO zu stärken und mittels Abschreckung Putin oder einem Nachfolger diese Grenze aufzuzeigen. Klar ist aber auch: Die Ukraine liegt jenseits dieser Grenze und ist daher für die NATO kein Abschreckungsfall. Die Ukraine gegen den unmissverständlich erklärten Willen Russlands wie einen westlichen Alliierten zu betrachten führt in eine Sackgasse. Russland ist eine Atommacht und allein deshalb Drahtzieher in einem ernst zu nehmenden Eskalationsszenario. Sollte seine Ukraine-Invasion vollends scheitern, wird Putin vermutlich andere Maßnahmen ergreifen. Und dann wäre der letzte Schritt eine desaströse nukleare Auseinandersetzung, gewollt oder ungewollt. Es gilt also, diesen Krieg zu Ende zu denken und nicht in eine unkalkulierbare Dauereskalation mit Russland zu geraten. Dabei darf Russland mit seinem Verhalten und Vorgehen in der Ukraine am Ende keinen Erfolg haben. „Was aber nicht passieren darf, ist ein apokalyptisches Scheitern."
Zugleich gilt es mittel- bis langfristig weiter zu versuchen, die europäische Sicherheitsordnung nicht gegen, sondern eines fernen Tages wieder mit Russland zu organisieren. Das erscheint angesichts des brutalen, von Russland begonnenen Angriffskriegs heute utopisch. Doch aus dem derzeitigen Sicherheitsdilemma – die Stärke des einen Akteurs wird vom gegnerischen Akteur zwangsläufig als Bedrohung wahrgenommen, woraus Abwehrmaßen resultieren, die abermals Rückwirkungen haben – gibt es keinen einfachen Ausweg. Sich mit der dauerhaften Teilung des Kontinents abzufinden, das kann keine verantwortbare Strategie sein. Auf der Basis gesicherter Abschreckungs- und Handlungsfähigkeit soll und kann der Westen in Gestalt von NATO und EU nicht hinnehmen, dass ein neuer Ost-West-Konflikt 2.0 die europäische und internationale Ordnung destabilisiert, sondern sollte mit aller Kraft an der Überwindung dieses Konflikts arbeiten.
Die hier für eine bestimmte Lesart der Ukraine-Krise herangezogene realistische Schule kann keineswegs beanspruchen, eine umfassende Erklärung für die katastrophale Entwicklung um und in der Ukraine und den desaströsen, völkerrechtswidrigen und allein von Russland zu verantwortenden Angriffskrieg zu liefern. Zu den zentralen Blindstellen dieser Theorie zählen die weitgehende Ausblendung der innenpolitischen Entwicklung Russlands unter Putin sowie die zunehmend imperiale, antiukrainische Ideologie mitsamt der inakzeptablen Negierung der ukrainischen Staatlichkeit. Dennoch liefert die Berücksichtigung einiger zentraler Lehren der realistischen Schule analytischen Mehrwehrt. Dieser betrifft die Vorgeschichte des Kriegs, die Frage, ob und wie vitale russische Interessen hätten Berücksichtigung finden sollen und auf welcher Basis künftig mit Russland umzugehen ist.
Kritik sowie Kritik an der Kritik gehört zu einem offenen wissenschaftlichen Diskurs. Die „Bringschuld" der Wissenschaft besteht darin, ihre Ideen und Konzepte auf eine verständliche, nachvollziehbare Weise zu formulieren – ohne sich allzu sehr der Logik der Politik zu verschreiben und durch einseitige Abhängigkeit Kritikvermögen und Kreativität einzubüßen. „Holschuld" der Politik wiederum ist es, den Diskurs mit der Wissenschaft suchen – auch um eigene Richtungsentscheidungen selbstkritisch zu hinterfragen und auf diese Weise neue Erfolg versprechende Ideen zu entwickeln.
By Johannes Varwick
Reported by Author