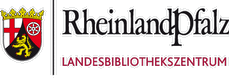Fox, Amos C. Lieutenant Colonel Reflections on Russia's 2022 Invasion of Ukraine. Combined Arms Warfare, the Battalion Tactical Group and Wars in a Fishbowl Washington, D.C. Association of the United States Army (AUSA) Oktober 2022
Die kurze, 18 Seiten umfassende Studie des amerikanischen Heeres-Oberstleutnants Amos C. Fox befasst sich mit der russischen Fähigkeit zur Gefechtsführung verbundener Waffen, den taktischen Bataillonskampfgruppen als Strukturelementen und den nicht übertragbaren Besonderheiten der Kriegführung auf engen Schauplätzen. Fox fasst seine Untersuchungsergebnisse in drei Sätzen zusammen:
- Die Invasion in der Ukraine und der nachfolgende Konflikt haben mehrere kritische Schwachstellen der russischen Streitkräfte aufgedeckt und auch die Kennzeichen von Kriegführung in engen gegenüber weiten Kriegsschauplätzen offenbart.
- Die Strukturierung in taktische Bataillonskampfgruppen – im Sinn von zum Gefecht der verbundenen Waffen schon auf der untersten Ebene, nämlich der von Bataillonen, befähigten und ad hoc zusammengestellten Kampfverbänden – hat sich als ungeeignet erwiesen für großangelegte militärische Operationen gegen einen staatlichen Akteur. Dieser Missgriff Russlands bei der Wahl seiner Streitkräftestruktur ist ein schwerwiegender Fehler, den es zu vermeiden gilt.
- Operationen und ihre Wirkungen auf kleinen Kriegsschauplätzen führen auf größeren Schauplätzen nicht zu demselben Gesamterfolg, wenn sie nicht von einem vergleichbar größeren Kriegsdispositiv und entsprechend umfangreicheren Kräften getragen werden.
Im Einzelnen arbeitet Fox heraus, dass der am 24. Februar 2022 begonnene Angriff auf die Ukraine über drei Angriffsachsen Ende März zwar Erfolge erbrachte, bestehend in der Einnahme des Hostomel-Flugplatzes bei Kyiv, dem Vordringen bis Charkiw und dem Herstellen einer Landverbindung zwischen dem Donbas und der Krim über Mariupol. Im weiteren Verlauf aber erwies sich Putins Strategie als die falsche, sein Plan als schlecht durchdacht und seine Einschätzung der eigenen Truppe sowie des ukrainischen Volks als völlig fehlgeleitet.
Russland habe keine Luftüberlegenheit erringen können, die ukrainischen Landstreitkräfte konnten nahezu ungestraft die russischen Land- und Luftstreitkräfte bekämpfen und ihnen hohe Verluste beibringen – auf russischer Seite über 50.000 gefallene Soldaten, 2097 zerstörte Kampfpanzer, 1194 Artilleriegeschütze, 300 Mehrfach-Raketenwerfer. Insgesamt würden die russischen Verluste in den ersten sechs Monaten auf 70.000 bis 80.000 Mann geschätzt. Diese Zahlen offenbarten eine großartige militärische Leistung der Ukraine und eine jämmerliche der russischen Streitkräfte, einhergehend mit einem hohen Maß an Undiszipliniertheit, niedriger Moral, Diebstahl, Desertion und Kriegsverbrechen.
Die schwache Leistung der russischen Streitkräfte erklärt der Verfasser einerseits mit der pragmatischen Fähigkeit des ukrainischen Militärs, verschiedene Kampfmethoden und -mittel flexibel und lageangepasst anzuwenden, statt starr an einem Ansatz festzuhalten, und so taktische Erfolge zu erzielen. Auf diese Weise sei der Ukraine durch Aneinanderreihung von Mini-Siegen ein taktischer und operativer Erfolg gelungen.
Andererseits habe die schwache Leistung der russischen Streitkräfte ihre Ursachen in unwirksamer Ausbildung, Schwächen in der Führung und einer für das vorliegende operative Umfeld falschen Organisationsstruktur. Ausbildung, Training/Übungen und Organisationsstruktur seien aber die maßgeblichen Voraussetzungen für erfolgreiche Kriegführung. Das Beherrschen des Gefechts verbundener Waffen ergebe sich aus einer passenden Organisation und Strukturierung der Streitkräfte; zudem müssten die Einheiten gut geführt und fähig sein, die Waffen aller Teilstreitkräfte wirksam zu integrieren, zu synchronisieren und bei der Führung der Operationen orchestriert einzusetzen. Bisher habe sich die russische Armee keineswegs als die tödliche Kriegsmaschine erwiesen, für die sie gehalten wurde. Vielmehr habe sich gezeigt, dass sie unzureichend ausgebildet und ausgestattet ist, um das Gefecht der verbundenen Waffen führen zu können, und dass das russische Heer für den Kriegsschauplatz unpassend strukturiert und organisiert worden ist. Die Bildung von ad hoc zusammengestellten Bataillonskampfgruppen führe nicht automatisch zu kohärenten Verbänden angemessener Größe, die sich für das Gefecht der verbundenen Waffen eignen, und genauso wenig zu einer disziplinierten Streitmacht. Die Schwächen träten in der niedrigen Moral und Disziplin und in den verlorenen Gefechten offen zutage.
Ausbildung und Übungen: Die Großübungsserien Zapad (Westen) und Vostok (Osten) dienten vor allem der Überprüfung von drei Fähigkeiten, (
Bataillonskampfgruppen-Struktur: Mit dem Konzept bataillonstaktischer Gruppen (BTG) hat Russland seit den 2010er-Jahren versucht, aus den durch Personalknappheit verursachten hohlen Strukturen seiner Brigaden und Divisionen das Beste zu machen, indem es in Übungen und jetzt im Einsatz für einen bestimmten Kampfauftrag ad hoc Kampfgruppen auf Bataillonsebene zusammenstellte. Doch dies Konzept habe sich nicht bewährt, weil zwischen den BTGs und den höheren Führungsebenen zu wenige funktionierende Führungskapazitäten bestehen. Diese ad hoc auftragsbezogenen Kampgruppen kämpfen im tatsächlichen Einsatz in der Ukraine völlig anders als bei ihrer Organisierung, Ausbildung und den Übungen in Friedenszeiten (was dem Erfolgsprinzip train as you fight widerspricht). Das hat unter anderem außergewöhnlich hohe Verluste unter Generälen und gravierende logistische Versorgungsprobleme bewirkt.
Das BTG-Konzept kleiner Kampfgruppen mit Befähigung zum selbstständigen Kampf der verbundenen Waffen hätte sich im engen Schauplatz des Donbas durchaus bewährt; dort betrug die Entfernung zur russischen Grenze und damit die Länge der logistischen Versorgunglinien selten mehr als 100 km. Das sei ein vergleichsweise kleiner Schauplatz mit einer Front von 420 km gewesen, in dem sich die BTGs auf sichere Versorgungslinien und Führungsgefechtsstände von Russland bis in ihre Kampfzone stützen konnten. Auch bedurfte es bei den Kämpfen im Donbas 2014/2015 keiner Aufklärung, dafür sorgten die unterstützenden Separatisten. Darüber hinaus seien die Ukrainer damals gezwungen gewesen, zwecks Rückeroberung gut befestigte Stellungen anzugreifen. In allen diesen Punkten stünden die russischen Streitkräfte bei ihrem Angriffskrieg seit Februar 2022 vor völlig anderen Herausforderungen. Jetzt seien Kyjiw und Charkiw Festungen und Basen der Machtprojektion, von denen aus die ukrainischen Streitkräfte ihr Land bis aufs Äußerste verteidigen. Mangels eigener Aufklärung seien die russischen Angriffskräfte blindlings in diese Räume gelaufen und die viel zu statisch operierenden russischen BTGs zu verwundbaren Zielen geworden. Besonders diese Unfähigkeit der BTGs, lokale Aufklärung über die gegnerischen Kräfte vor ihnen und um sie herum zu betreiben, habe enorme Verluste verschuldet. Ähnlich stellten die sanitätsdienstliche Versorgung von Verwundeten oder Wartung liegengebliebener Fahrzeuge für die russischen BTGs im Donbas 2014/2015 kein Problem dar, wohl aber bei ihren Operationen im feindlichen Umfeld in der Ukraine im Februar und März 2022.
Ein drittes Problem besteht offensichtlich in mangelnder Funk- und Kommunikationsdisziplin. Konnten die BTG-Kräfte sich das im Donbas 2014/2015 noch ungestraft leisten, führte es 2022 infolge ukrainischer signalbasierter Aufklärung und Zielerfassung zu schweren Verlusten an Führungspersonal bis hin zur Vernichtung einer ganzen BTG bei einem Flussübergang. Der Autor leitet aus seinen Vergleichen zwischen dem BTG-Erfolg im kleinen Donbas-Gebiet und dem Scheitern der Invasionsoperation im März 2015 auf dem viel größeren Kriegsschauplatz Ukraine folgende grundsätzlichen Unterschiede der Kriegführung ab:
Die Effekte, die ein Akteur durch Massierung und Aufrechterhalten von Kräften erreichen kann, seien in kleinen deutlich größer als in weiträumigen, für ihn weniger sicheren Schauplätzen. Bei engen Schauplätzen träten signifikante Probleme nicht vollumfänglich zutage, weil die eigenen Kräfte sie schneller bewältigen können. So blieben sie lange unerkannt, bis die Geographie – Entfernungen, Gelände, natürliche und künstliche Strukturen – sie bei Feindberührung schließlich ans Licht bringe. So hätte z. B. Aserbaidschans binnen sechs Wochen erzielter Sieg über Armenien zu der unzutreffenden Einschätzung geführt, durch die moderne Kriegführung Aserbaidschans mit Drohnen im Gefecht verbundener Waffen hätte sich die alte Kriegführung mit Panzern und generell Landkrieg als überholt erwiesen. Man dürfe jedoch auf kleinen Schauplätzen wirksame Mechanismen nicht unreflektiert auf größere übertragen, sondern müsse das für letztere nötigen Erfordernis umfangreicherer Kräfte beachten. Positive Wirkungen gegenüber einem Gegner seien auf kleinen Schauplätzen schneller, billiger und leichter zu erreichen als auf großen. Bei diesen können Faktoren wie Bewegungen, Zielidentifikation und Entfernungen die vermeintlichen Segnungen moderner Technologien, die als Game Changer gelten, relativieren. So hätten 2014 im Donbas die BTGs wie ins Aquarium geworfene Steinbrocken beachtliche Wirkung erzielt, weil der Schauplatz eng begrenzt war, die BTGs von ihren Ausgangsorten in Russland aus unverbraucht in voller Kampfkraft an die Front vorrücken konnten, die Nachschubwege kurz und nicht gefährdet waren. Probleme hinter der Front oder in der Etappe konnten in Russland behoben und auftretende Führungsprobleme schnell aus den nahen rückwärtigen Gefechtsständen heraus gelöst werden. Somit bewährten sich die BTGs, solange es sich um eine Art Operation zur Niederschlagung von Aufständischen auf einem kleinen Gebiet handelte.
Das habe sich allerdings nicht auf die gegenwärtige Invasionsoperation in der Ukraine übertragen lassen. Hier hätten sich die BTGs als schlecht geeignet erwiesen: wegen der rigoroseren Anforderungen des weiträumigen Kriegsschauplatzes, der umkämpften Nachschub- und Kommunikationslinien, des im Kampf entschlossenen Gegners. So seien die erlernten falschen Lektionen und Gewohnheiten aus dem Krieg im Donbas den russischen BTGs nun in der Ukraine zum Verhängnis geworden, da deren Strukturen maximal auf kleine, nicht aber nicht auf große Kriegsschauplätze ausgelegt waren. Allerdings: Je mehr die erfolgreichen Gegenangriffsoperationen der Ukraine den Raum ostwärts Richtung Russland wieder verengen, desto besser lassen sich die BTGs erneut einsetzen, führen und versorgen.
Die prinzipielle Schlussfolgerung des Autors lautet: Politische und militärische Entscheidungsträger sollten nicht den Fehler begehen, Lektionen aus kleinen Kriegsschauplätzen generell und unreflektiert auf größere mit ihrer anders gearteten Kriegführung zu projizieren, und sollten nicht annehmen, die Mechanismen erfolgreicher kleiner Kriege hätten die Kriegführung grundsätzlich weitreichend verändert.
Wertung: Die Betrachtungen des Autors liefern eine plausible Erklärung für das erstaunliche Versagen der russischen Invasionsstreitkräfte in den ersten Wochen des Angriffskriegs im Februar und März 2022. Allerdings dürften die Schwächen und Grenzen der BTG-Streitkräftestruktur auch auf russischer Seite erkannt und entsprechende Veränderungen eingeleitet worden sein. Auch wenn die ukrainischen Streitkräfte in der folgenden Phase die Initiative gewinnen und erhebliche Teile der von Russland gehaltenen Gebiete zurückerobern konnten, so hat es im Winter 2022/23 doch den Anschein, als ob die russischen Verteidigungslinien im Donbas und zur Krim hin halten und die Initiative in diesem zu einem Abnutzungskrieg gewordenen Konflikt wieder auf die russische Seite übergegangen ist. Der Logik diese Kurzstudie folgend, wäre es wert zu untersuchen, dank welcher Veränderungen von Strukturen und Operationsführung den russischen Streitkräften dieser Erfolg gelungen ist.
https://
By Rainer Meyer zum Felde
Reported by Author
Non-Resident Fellow