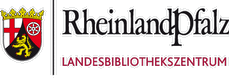Quellenforschung im 21. Jahrhundert. Vorträge der Veranstaltungen zum 200-jährigen Bestehen der MGH vom 27. bis 29. Juni 2019, hg. v. Martina Hartmann/ Horst Zimmerhackl unter Mitarbeit von Anna Claudia Nierhoff (= Monumenta Germaniae Historica, Schriften 75). Harrassowitz, Wiesbaden 2020. VII u. 252 S. sowie 22 Abb., ISBN 978-3-447-11387-8
Welche Editionen brauchen wir noch? In welcher Form sollen sie dem Leser vorgelegt werden? Wo ist die Grenze zwischen Edieren und Interpretieren zu ziehen? In den letzten Jahrzehnten sind diese und ähnliche Fragen hin und wieder gestellt worden. Das 200-jährige Jubiläum der MGH hat diesem Forschungsinstitut erneut einen Anlass gegeben, zwei Bücher zu dieser Thematik herauszugeben. Das eine ist die Festschrift „Mittelalter lesbar machen"), eine Prachtausgabe, die einen Überblick über die Geschichte der MGH mit einschlägigen Dokumenten bietet und neue Vorhaben unterbreitet; das andere ist der hier zu besprechende Tagungsband „Quellenforschung im 21. Jahrhundert", der dreizehn Aufsätze prominenter Quellenforscher enthält, die als Vorträge der Jubiläumsveranstaltung entstanden sind. Sie stellen große Leistungen der MGH vor oder diskutieren neue Aufgabenfelder und technische Möglichkeiten.
Die Aufsätze sind dem Ablauf der Veranstaltung entsprechend geordnet und in drei Teile aufgegliedert: „A. Einblicke in die ‚Werkstatt' der Editoren", „B. Quelleneditionen und Forschungstrends" und „C. Editorische Herausforderungen der Zukunft".
Der erste Teil enthält fünf Aufsätze, die einem interessierten Publikum erfolgreich abgeschlossene oder gut gediehene Projekte der MGH vorstellen. Theo Kölzer „Die Editionen der merowingischen Königsurkunden und Kaiser Ludwigs des Frommen" und Wilfried Hartmann „Die Edition der Concilia aus der Zeit der karolingischen Teilreiche (843–911)" erläutern die Überlieferungsverhältnisse und Überlieferungsformen ihrer Quellen. Kölzer zeigt, welche Auswirkungen die strenge Überlieferungskritik der frühmittelalterlichen Urkunden auf allgemein-historische Fragen haben kann, während Hartmann im Einzelnen ausführt, wie die einschlägigen Texte der Konzilien aus der Zeit der karolingischen Teilreiche aufgezeichnet wurden und auf uns gekommen sind, was auch das Prinzip seiner Edition bestimmt: Er sucht nämlich nicht, das Original zu rekonstruieren, sondern verschiedene Fassungen aufzubewahren, um den realen Überlieferungsverhältnissen gerecht zu werden.
Anders verhält es sich mit dem literarischen Text, wie Alexander Patschovsky „Die Concordia Novi et Veteris Testamenti Joachims von Fiore († 1202) – Entstehungsprozess und editorische Leitlinien" erklärt. Patschovsky strebt in seiner MGH-Edition nach der Rekonstruktion des auktorialen Textes, wie er von Joachim von Fiore verfasst wurde. Um das Ziel zu erreichen, kollationiert er die gesamte Überlieferung an dem ausgewählten Abschnitt des Textes, wobei der Textabschnitt „umfangreich genug sein [muss], um die Ergebnisse seiner überlieferungskritischen Analyse auf den Gesamttext übertragen zu können, und doch knapp genug, um den Zeitaufwand nicht ins Ungemessene steigen zu lassen". Von ca. 40 Zeugen sind sechs Handschriften ausgewählt worden, aufgrund derer der Text nach den Lachmann- schen Prinzipien rekonstruiert worden ist.
Während die MGH-Diplomata oder die Concilia bestimmte Quellengattungen zum Gegenstand haben, folgt die Edition der für die Reichsverfassung relevante Quellen einem sachthematischen Auswahlprinzip. Michael Menzel „Die Reihe der Constitutiones bei den MGH" erklärt das Konzept und den Plan dieser Reihe.
Bernd Posselt „Die erste digitale Edition der MGH: Ulrich Richentals Chronik des Konzils von Konstanz" führt den Leser in eine neue Dimension des Edierens ein, d. h. die Arbeit mit XML). Das Thema wird auch in Teil C von Thomas McCarthy und teilweise auch von Eva Schlotheuber (s. u.) behandelt.
Der zweite Teil beginnt mit dem Aufsatz Klaus Herbers „Ein Nürnberger Arzt 1494/95 auf Westeuropareise – Zu seinem und anderen Reiseberichten", der die Edition des Itinerarium des Hieronymus Münzer vorstellt, die erste der neuen Reihe „Reiseberichte des Mittelalters". Das Werk ist in einer einzigen Handschrift erhalten. Der Schwerpunkt der Editionsarbeit liegt nicht in der Rekonstruierung des Textes, sondern in der Aufarbeitung der Grunddaten in der Einleitung der Edition und vor allem in der Kommentierung, die, konzediert Herbers, für manchen zu umfangreich ausfallen könnte. Er rechtfertigt sich mit dem Argument, erst sie ermögliche eine angemessene Einordnung von Reise- und Alteritätserfahrungen. In diesem Zusammenhang weist er auf die in quellenkritischer Hinsicht oft rudimentäre Textbasis der Reise- und Reiseberichtsforschung hin. In Bezug auf Digitalisierung bemerkt Herbers auch nur beiläufig die Vernetzung der elektronischen Fassungen der Reiseberichte als eine Aufgabe der Zukunft, sodass die herkömmlichen Register gleichsam elektronisch zusammengeführt und als Einzelregister überflüssig werden sollten.
Karl Borchard „Die Monumenta Germaniae Historica und die Kreuzzüge" bietet einen gut anschaulichen, historischen Überblick über Forschungstrends, relevante Editionen der MGH und wesentliche Quellensammlungen anderer Forschungszentren.
Benedikt Marxreiter „Die historiographische Rezeption des sog. Daibert- Briefes im Rahmen der Bamberger Weltchronistik des 11./12. Jahrhunderts" ist in der Zusammenschau mit Thomas J.H. McCarthy „Jenseits des platonischen Texts: Digitale Hilfsmittel und ihr Nutzen für die Erfassung textlicher Komplexität in chronikalen Schriften des Mittelalters" in Teil C zu lesen. Während McCathy, um die Vorstellung von dem einheitlichen Originaltext als Mythos zu erweisen, einen Überblick über die verschiedenen Stufen der Entwicklung der Bamberger Weltchronik bietet und für den Nutzen der digitalen Hilfsmittel für die Erfassung der Komplexität des Textes plädiert, handelt es sich bei dem Aufsatz Marxreiters um eine Detailarbeit, die die Rezeption des sog. Daibert-Briefes, einer der Quellen zum ersten Kreuzzug, in der Weltchronik Frutolfs und ihrer Fortsetzung wie Überarbeitung verfolgt.
Martin Wihoda „Die MGH und die moderne Geschichtsschreibung in den böhmischen Ländern" beginnt seine Ausführung mit der Frage, ob die Geschichtswissenschaften, in deren Rahmen die kritische Editionsarbeit, für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts überhaupt von Nutzen sein könne. Der Hintergrund hierfür ist die Beobachtung des tschechisch-jüdischen Historikers František Graus (114 Anm. 5), dass der zweite Weltkrieg die Wahrnehmung der Geschichte als Nationalgeschichte in Frage gestellt und den weitgehenden Verlust der gesellschaftlichen Aussagekraft der historischen Forschung mit sich gebracht habe. Graus stellte aber auch die Sehnsucht nach einer neuen nationalen Geschichtsschreibung bei den meisten tschechischen Historikern noch lange nach dem zweiten Weltkrieg fest. Ausgehend von diesen Beobachtungen erörtert Wihoda die Geschichte der tschechischen Geschichtsschreibung vor dem zweiten Weltkrieg, die charakterisiert war von einem enthusiastischen Patriotismus einerseits und andererseits von der von Theodor von Sickel und Georg Waitz in den MGH geprägten, sich gegenüber äußeren Anregungen öffnenden Editionssarbeit. Dieses Spannungsverhältnis wird am Beispiel des deutsch-jüdischen Quellenforschers Berthold Bretholz (1862–1936) eindringlich geschildert, der für die Tschechen ein Deutscher, für die Deutschen ein Jude gewesen sei und als Fremdling auf beiden Seiten keine universitäre Karriere habe machen können. Wihoda hebt trotzdem ausdrücklich hervor, dass die kritische Quellenarbeit selbst in Zeiten ethnisch oder sozial motivierter Intoleranz Historiker miteinander verbunden habe und weiter verbinden werde.
Arno Mentzel-Reuters „Wissensordnung im Zusammenhang mit Johannes Trithemius" beschäftigt sich mit dem Phänomen „Wissensexplosion" an der Schwelle zur Neuzeit und ihre Bewältigungsversuche bei Johannes Thrithemius. Es handelt sich um eine sorgfältige Analyse von dessen historischen Werken. Wertvoll ist u.a. die Erkenntnis, dass Trithemius sich um ein nachvollzierbares Ordnungssystem bemüht habe, dessen Operabilität höher angesetzt worden sei als die historische Wahrheit, sodass seine historischen Werke das Zeitverständnis der maximilianeischen Epoche widerspiegeln würden und Primärquellen ersten Ranges seien, die der Editor kommentieren und analysieren müsse und nicht etwa niederzumähen habe.
Der letzte Teil enthält neben der bereits erwähnten Arbeit McCarthys zwei Aufsätze. Der eine ist Eva Schlotheuber „Die Kunst der Kommunikation – Die Briefbücher der Benediktinerinnen von Lüne und ihre digitale Edition als methodischer Neuansatz". Es geht um die drei im Klosterarchiv Lüne aufbewahrten Briefkopiale (Hss. 15, 30, 31), die Abschriften der ein- und ausgehenden Briefe von ca. 1450–1550 enthalten. Schlotheuber verortet diese Kopiale in der von Klosterreform ausgelösten umfassenden schriftlichen Reflexion des Klosteralltags. Die strenge Klausur und ein von der verinnerlichten Frömmigkeit der devotio moderna getragener Bildungsansatz sollen die Nonnen dazu geführt haben, eine in administrativer wie intellektueller Hinsicht anspruchsvolle Briefkunst und mehrschichtige Kommunikationsnetzwerke zu entwickeln. Es handelt sich um einen Befund, der „das in der Reformation propagierte und in der Forschung lange nachhallende Bild der Frauenklöster zerstöre[...]". Die an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel gehostete digitale Edition der Kopiale dient sowohl historisch-kritischen wie auch philologischlinguistischen Forschungen und funktioniert auch als Datenbank, die verschiedene Kommunikationsebenen und Intertextualität der Briefe anschaulich macht.
Der andere und letzte Aufsatz ist Enno Bünz „Serielle Quellen des späten Mittelalters – Herausforderungen, Möglichkeiten und Grenzen der editorischen Arbeit angesichts beginnender Massenüberlieferung". Demnach ist das Spätmittelalter ein Forschungsgebiet, in dem die MGH trotz des großen Interesses der historischen Forschung der letzten Jahrzehnte bisher nur begrenzt präsent gewesen seien und in Zukunft stärker tätig sein werden. Angesichts des Phänomens der Massenüberlieferung im Spätmittelalter sei es aber nicht möglich, stets die Vollständigkeit zu erzielen, wie sie von den Editionen der MGH gefordert worden ist. Bünz bietet zunächst einen Überblick über Editionsarbeiten an spätmittelalterlichen Quellen, die außerhalb der MGH getrieben worden sind. Dann schildert er anhand von konkreten Beispielen sechs Modelle, wie die Editionen der spätmittelalterlichen Quellen aussehen sollten; das sind I. Vollständige Edition, II. Sach- thematische Auswahledition, III. Verbindung von Edition, Aktenreferat und Regest, IV. Das Regestenwerk, V. Repertorium und Kurzregest und VI. Das analytische Inventar. Als eine Aufgabe der MGH von besonderem Gewicht schlägt Bünz die Edition der Provinzial- und Diözesanstatuten des 13. bis 16. Jahrhunderts aus dem Bereich der Germania sacra, d. h. von zehn Kirchenprovinzen mit 56 Diözesen, vor. Zum Schluss betont er grundsätzlich die Bedeutung der Quellen als Rohstoff der historischen Arbeit.
Mit dem Tagungsband „Quellenforschung im 21. Jahrhundert" öffnen sich die MGH einer breiten Leserschaft, die sich für das Mittelalter interessiert. Ein Akzent liegt auf dem Spätmittelalter als neuem Aufgabenfeld, ein anderer auf den Möglichkeiten der digitalen Edition, sei es lediglich als neue Präsentationsart, sei es als wesentliches Werkzeug des Historikers. Aufgrund der leserfreundlichen Darstellungsweise der letzten drei Aufsätze könnte es dem Leser leichter fallen, bei der Lektüre mit dem Aufsatz von Enno Bünz anzufangen und das Buch rückwärts zu lesen, um die Aufsätze in den großen Zusammenhängen der Thematik „Quellenforschung im 21. Jahrhundert" zu erfassen.
By Tatsushi Genka
Reported by Author