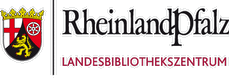Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 und die darauf folgende rasante Steigerung der Energiepreise haben die Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland und Europa wieder in den öffentlichen und politischen Fokus gerückt. Vor diesem Hintergrund quantifizieren Manuel Frondel, Sven Hansteen, Marielena Krieg und Christoph M. Schmidt die rohstoffspezifischen Risiken Deutschlands in der Versorgung mit Erdöl, Steinkohle und Erdgas seit Ende der siebziger Jahre sowie das Risiko der Energieversorgung für Deutschland insgesamt. Es folgt ein einordnender Vergleich mit den übrigen G7-Staaten. Dabei zeigt sich, dass das Risiko der Energieversorgung dem von Frondel und Schmidt (2009) konzipierten Indikator zur Messung der langfristigen Energieversorgungssicherheit zufolge seit dem Ende der siebziger Jahre stark gestiegen ist. Dies geht vor allem auf die massive Zunahme der Rohöl-, Steinkohle- und Erdgasimporte aus Russland bei einem gleichzeitigen Rückgang der heimischen Anteile an der Versorgung mit Erdöl, Steinkohle und Erdgas zurück. Der Beitrag illustriert, wie eine stärkere Diversifizierung der Importe von Energierohstoffen hinsichtlich der Bezugsländer sowie der Energierohstoffe und -technologien die Sicherheit der Energieversorgung erhöhen könnte.
Der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat die Sicherheit der Versorgung Deutschlands und Europas mit Energierohstoffen schlagartig zu einem Thema von höchster Priorität werden lassen (acatech, Leopoldina und Akademienunion 2022 sowie [
Die große Abhängigkeit von Rohölimporten aus Ländern der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC), die Deutschland in Zeiten der Ölkrisen der siebziger Jahre schwer zu schaffen gemacht hatte, war somit gegen eine noch größere Abhängigkeit von Russland eingetauscht worden. Dies zeichnete sich schon vor einem Jahrzehnt deutlich ab ([
Mit der Fertigstellung der zusätzlichen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sowie der Umsetzung der Beschlüsse zum Ausstieg aus der Kernenergie- und der Kohleverstromung wurde der Weg bereitet, Deutschlands Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland sogar noch weiter zu steigern. Der Einsatz von Erdgas galt als die zentrale Brücke in Richtung eines defossilisierten Energiesystems – und die Politik vertraute darauf, dass Russland die sichere Versorgung mit den dafür benötigten Mengen an Erdgas gewährleisten würde. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat dieses Vorhaben zerschlagen und das Szenario einer noch weiter steigenden Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energieimporten sehr unattraktiv werden lassen. Vielmehr ist nun davon auszugehen, dass Deutschland in absehbarer Zukunft keine fossilen Energierohstoffe aus Russland mehr beziehen wird.
Vor diesem Hintergrund quantifizieren wir in diesem Beitrag die Sicherheit der Versorgung Deutschlands mit Energie auf Basis des von [
Bei der empirischen Berechnung des langfristigen Energieversorgungsrisikos finden sämtliche Energierohstoffe und -technologien Berücksichtigung, sowohl die fossilen Energierohstoffe Öl, Kohle und Gas als auch Kernenergie und nicht zuletzt die erneuerbaren Energien. Die wesentlichen Bestandteile, die zur empirischen Umsetzung des Indikators herangezogen werden, sind erstens die Importanteile der diversen Rohstoffbezugsländer sowie der Anteil der inländischen Förderung eines jeden Rohstoffs an dessen gesamtem Angebot in Deutschland, zweitens die Wahrscheinlichkeiten, mit denen in diesen Ländern mit Angebotsunterbrechungen zu rechnen ist, und drittens die Anteile einzelner Energierohstoffe und -technologien am Primärenergiemix.
Im Ergebnis zeigt sich, dass das Risiko der Versorgung mit Energie in Deutschland seit dem Ende der siebziger Jahre massiv gestiegen ist. Dieser Anstieg ist sehr wesentlich auf die starke Zunahme der Rohöl-, Steinkohle- und Erdgasimporte aus Russland bei einem gleichzeitigen Rückgang der heimischen Anteile an der Versorgung mit Erdöl, Steinkohle und Erdgas zurückzuführen. Unter den G7-Staaten wies Deutschland damit kurz vor dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine und der damit verbundenen Zeitenwende bezüglich Sicherheit und Resilienz (Wörner und Schmidt 2022) das zweithöchste Risiko in der Versorgung mit Energierohstoffen nach Italien auf. Im Gegensatz zu den Tendenzen in Frankreich und Japan zeigt sich für dieses Risiko zudem ein stark aufwärtsgerichteter Trend.
Im folgenden zweiten Abschnitt erläutern wir das von [
Das von Frondel und Schmidt (2007) vorgeschlagene Maß zur Quantifizierung des rohstoffspezifischen Risikos der Versorgung mit Energierohstoff i beruht auf einer Modifizierung des üblicherweise zur Messung von Marktkonzentration verwendeten Herfindahl-Index ([
Graph
(
wobei x
Graph
den Risikovektor. Länger anhaltende Ausfälle bei der heimischen Gewinnung von Rohstoffen sollten ausgeschlossen werden können, sodass von r
Graph
(1´)
Falls x
Die im Vektor
Graph
mit
Graph
erfassten Anteile der jeweiligen Lieferländer an der Versorgung mit Rohstoff i sind aus Sicht eines Importlandes der primäre Hebel, um das Versorgungsrisiko zu beeinflussen. Rohstofflieferanten mit geringem Anteil x
Andererseits fallen Lieferungen aus Ländern mit einem hohen Anteil, so wie bis vor kurzem aus Russland, vergleichsweise stark ins Gewicht, sodass sich eine Konzentration auf ein risikoreiches Land in einem großen Wert des Risikoindex niederschlägt. Umgekehrt wirkt sich die Aufteilung des Bezugs auf zwei Quellen mit gleichem Risiko aufgrund der Quadrierung der Gewichte risikomindernd aus, also genau so, wie man dies bei einer stärkeren Diversifizierung erwarten würde. Der Indikator des rohstoffspezifischen Risikos umfasst somit drei Aspekte, die bei der Messung von Versorgungssicherheit von Bedeutung sind: (i) den Anteil der heimischen Förderung x
Volkswirtschaften greifen für ihre Energieversorgung typischerweise auf eine Kombination verschiedener Energierohstoffe zurück, die in sehr unterschiedlichem Umfang importiert werden. Um die Verletzlichkeit eines Landes hinsichtlich der gesamten Versorgung mit Energie zu erfassen, schlugen Frondel und Schmidt (2009) eine unmittelbare Verallgemeinerung des rohstoffspezifischen Risikos nach Gleichung (
Graph
(
Bei dieser quadratischen Form stellt w
Wie bei der Erfassung der rohstoffspezifischen Risiken enthalten die Spalten der Matrix X neben den jeweiligen Anteilen der Bezugsländer x
Graph
(
Tabelle 1: Anteile verschiedener Herkunftsländer an der Erdgasversorgung Deutschlands
Herkunft 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2019 Deutschland 76,7 % 32,2 % 25,8 % 22,5 % 12,8 % 7,9 % 5,0 % Niederlande 23,3 % 33,6 % 26,8 % 19,3 % 21,8 % 20,4 % 9,8 % Norwegen 0,0 % 12,2 % 11,1 % 18,8 % 28,3 % 29,8 % 32,6 % Russland 0,0 % 21,9 % 35,7 % 35,4 % 31,9 % 39,2 % 48,5 % Übrige 0,0 % 0,1 % 0,6 % 4,0 % 5,2 % 2,7 % 3,6 %
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten aus IEA 2022a, b
Tabelle 2: Anteile diverser Herkunftsländer an der Rohölversorgung Deutschlands
Herkunft 1980 1990 2000 2010 2015 2019 Algerien 5,2 % 3,8 % 6,1 % 1,1 % 3,8 % 1,3 % Deutschland 3,8 % 4,0 % 3,0 % 2,7 % 2,6 % 2,2 % Irak 2,8 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 2,6 % 3,0 % Iran 4,8 % 3,1 % 0,8 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % Libyen 12,2 % 12,5 % 11,1 % 7,8 % 3,1 % 9,4 % Nigeria 8,8 % 6,7 % 1,9 % 4,2 % 7,3 % 5,9 % Norwegen 2,4 % 7,2 % 17,5 % 9,5 % 13,6 % 10,9 % Russland 18,7 % 23,2 % 32,0 % 36,3 % 35,7 % 30,5 % Saudi-Arabien 19,8 % 6,5 % 4,3 % 0,8 % 1,3 % 1,8 % Venezuela 1,3 % 5,0 % 1,8 % 1,3 % 0,1 % 0,9 % V. Arab. Emirate 5,1 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % UK 11,8 % 16,2 % 12,2 % 14,1 % 10,9 % 11,5 % Übrige 3,3 % 10,8 % 9,1 % 20,3 % 18,8 % 21,6 %
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten aus IEA 2022c, d
Die Diagonalelemente π
Graph
. Die übrigen, nichtverschwindenden Elemente von
Graph
für k, l = 1, ..., I, k, ≠ l, berücksichtigen die Tatsache, dass beispielsweise Versorgungsunterbrechungen in einem Exportland bei den Öllieferungen mit solchen bei Gas korreliert sein können. So zeigen die aktuellen Konflikte mit Russland sehr deutlich, dass Probleme in der Ölversorgung auch Schwierigkeiten in der Gasversorgung zur Folge haben können. Zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Indikator für das Risiko der gesamten Energieversorgung eines Landes konstruktionsbedingt ebenso normiert ist wie das rohstoffspezifische Risiko: 0 ≤ Risiko ≤ 1.
Seit den Ölpreiskrisen der siebziger Jahre hatte Deutschlands Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland beinahe beständig zugenommen. So beruhte die Gasversorgung Deutschlands 2019 mit einem Importanteil von rund 49 Prozent zu knapp der Hälfte auf Lieferungen aus russischen Gasfeldern (Tabelle 1). Im Jahr 1970 hingegen wurde die Gasversorgung Deutschlands noch zu rund drei Vierteln aus heimischen Quellen sichergestellt – allerdings bei einem deutlich niedrigeren Gasverbrauch als heute. Den übrigen Teil steuerten damals die Niederlande bei.
Mit Inbetriebnahme der durch die Ostsee führenden Pipeline Nord Stream I im Jahr 2011 ist die Abhängigkeit von Erdgasimporten aus Russland im vergangenen Jahrzehnt stark angestiegen: von einem Importanteil von rund 32 Prozent im Jahr 2010 über einen Anteil von rund 39 Prozent im Jahr 2015 auf etwa 55 Prozent 2021 (Deutscher Bundestag 2022). Im Gegenzug ist der Anteil der Erdgasimporte aus den Niederlanden in den vergangenen Jahren massiv gesunken und betrug 2019 weniger als 10 Prozent. Auch der heimische Beitrag zu Deutschlands Versorgung mit Erdgas ist in den vergangenen Jahren weiter gefallen; dieser Trend ist seit den siebziger Jahren ungebrochen.
Tabelle 3: Anteile diverser Herkunftsländer an der Steinkohleversorgung Deutschlands
Herkunft 1980 1990 2000 2010 2015 2019 Australien 0,5 % 1,3 % 5,7 % 3,0 % 5,4 % 11,6 % China 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,6 % 2,3 % Deutschland 85,4 % 84,9 % 57,2 % 15,4 % 11,8 % 0,0 % Kolumbien 0,0 % 0,1 % 4,2 % 14,8 % 13,0 % 4,6 % Polen 1,7 % 3,0 % 10,4 % 11,5 % 4,7 % 0,5 % Russland 0,2 % 0,4 % 1,4 % 19,9 % 26,5 % 46,7 % Südafrika 1,3 % 5,0 % 7,0 % 5,3 % 4,9 % 2,0 % USA 2,0 % 0,8 % 1,1 % 6,5 % 9,8 % 20,9 % Übrige 8,7 % 4,5 % 12,9 % 13,3 % 23,3 % 11,4 %
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten aus IEA 2022e, f
Tabelle 4: Primärenergiemix Deutschlands
1980 1990 2000 2010 2015 2019 Erdöl 40,8 % 35,3 % 38,3 % 32,9 % 32,9 % 35,2 % Erdgas 14,2 % 15,4 % 20,9 % 22,3 % 21,1 % 25,1 % Steinkohle 17,5 % 15,5 % 13,4 % 12,1 % 13,3 % 9,1 % Kernkraft 4,0 % 11,2 % 12,9 % 10,8 % 7,8 % 6,4 % Braunkohle 21,7 % 20,6 % 11,3 % 10,6 % 12,5 % 8,5 % Erneuerbare etc. 1,8 % 2,0 % 3,2 % 11,3 % 13,8 % 15,7 %
Anmerkung: Die Kategorie „Erneuerbare etc." beinhaltet unter anderem Wasserkraft, Wind- und Solarenergie. Quelle: Eigene Berechnungen der Anteile auf Basis von Daten aus IEA 2022 sowie für 2019 aus AGEB 2021
Die mit dem hohen russischen Gasimportanteil verbundene Abhängigkeit Deutschlands wurde dadurch verschärft, dass Russland auch bei der Versorgung Deutschlands mit Rohöl und Steinkohle die mit weitem Abstand führende Rolle einnahm. So betrug der Anteil Russlands zur Rohölversorgung Deutschlands im Jahr 2019 knapp 37 Prozent (Tabelle 2) und bei der Versorgung mit Steinkohle mehr als 50 Prozent (Tabelle 3).
Besonders bemerkenswert ist, dass die Abhängigkeit von Russland in der vergangenen Dekade noch einmal deutlich zunahm, vor allem im Hinblick auf Steinkohle und Erdgas. Dies verdeutlicht Abbildung 1, die das nach Gleichung (
Seit dem Beginn der achtziger Jahre hat sich der Primärenergiemix Deutschlands deutlich verändert (Tabelle 4). Während Steinkohle und die heimische Braunkohle erheblich an Bedeutung verloren, blieb Erdöl mit einem ungefähr gleichbleibenden Anteil von 35 Prozent bedeutsam. Gestiegen ist vor allem der Anteil von Erdgas, von etwas mehr als 14 Prozent auf über ein Viertel. Zudem machen Erneuerbare mittlerweile fast 16 Prozent aus.
In der Gesamtbetrachtung hat der Anstieg der rohstoffspezifischen Risiken, vor allem bei Steinkohle und Erdgas, seit 2010 zu einer erheblichen Zunahme des gesamten Energieversorgungsrisikos Deutschlands geführt (Abbildung 2). Tendenziell ist das Energieversorgungsrisiko Deutschlands seit Beginn der achtziger Jahre somit immer weiter gestiegen. Mit Ausnahme von Italien fallen die Versorgungsrisiken der übrigen G7-Staaten nach dem Indikator von Frondel und Schmidt (2009) mittlerweile deutlich niedriger aus, wie im folgenden Abschnitt vertieft wird. Nachdem es Deutschland geschafft hat, seine Importabhängigkeit von Russland bis zum Jahr 2023 auf null zu reduzieren, ist das Versorgungsrisiko dem Indikator zufolge derweil wieder deutlich zurückgegangen, auf etwa das Niveau der achtziger Jahre (Frondel 2022).
Graph: Abbildung 1: Rohstoffspezifische Risiken bei der Versorgung Deutschlands mit Öl, Gas und Steinkohle nach dem von Frondel und Schmidt (2007) vorgeschlagenen Konzept, Gleichung (
Graph: Abbildung 2: Langfristiges Versorgungsrisiko der G7-Staaten mit Primärenergie (Deutschland 1980: 100)Quelle: Eigene Darstellung
Tabelle 5: Primärenergiemix Italiens
1980 1990 2000 2010 2015 2019 Erdöl 69,4 % 58,5 % 51,3 % 38,3 % 35,1 % 35,8 % Erdgas 16,3 % 25,6 % 33,7 % 40,0 % 36,2 % 40,9 % Steinkohle 8,4 % 9,6 % 7,3 % 8,3 % 8,1 % 4,4 % Kernkraft 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Braunkohle 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Erneuerbare etc. 5,5 % 6,3 % 7,7 % 13,4 % 20,6 % 18,9 %
Quelle: Eigene Berechnungen der Anteile auf Basis von Daten aus IEA 2022g
Tabelle 6: Primärenergiemix Japans
1980 1990 2000 2010 2015 2019 Erdöl 68,0 % 57,1 % 50,4 % 40,6 % 43,0 % 38,4 % Erdgas 6,2 % 9,9 % 12,6 % 17,2 % 23,3 % 22,2 % Steinkohle 17,2 % 17,4 % 17,5 % 23,0 % 27,3 % 27,8 % Kernkraft 6,2 % 11,8 % 16,1 % 15,0 % 0,6 % 4,0 % Braunkohle 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Erneuerbare etc. 2,4 % 3,8 % 3,4 % 4,1 % 5,8 % 7,7 %
Quelle: Eigene Berechnungen der Anteile auf Basis von Daten aus IEA 2022g
Tabelle 7: Primärenergiemix Frankreichs
1980 1990 2000 2010 2015 2019 Erdöl 55,9 % 38,4 % 33,9 % 28,9 % 28,8 % 27,3 % Erdgas 11,2 % 11,4 % 13,9 % 16,3 % 14,2 % 15,5 % Steinkohle 16,6 % 8,5 % 5,8 % 4,6 % 3,6 % 3,0 % Kernkraft 8,2 % 36,0 % 42,0 % 42,8 % 44,0 % 42,9 % Braunkohle 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Erneuerbare etc. 7,7 % 5,3 % 4,4 % 8,4 % 9,4 % 11,3 %
Quelle: Eigene Berechnungen der Anteile auf Basis von Daten aus IEA 2022g
Bereits im Jahr 2010 wies Deutschland unter den G7-Staaten nach dem Risikoindikator von Frondel und Schmidt (2009) das zweithöchste Risiko bei der Versorgung mit Energierohstoffen auf, nach Italien (Frondel, Ritter und Schmidt 2012). Italien konnte seine Position seitdem nicht verbessern: dem Risikoindikator zufolge stieg nicht nur das Energieversorgungsrisiko Deutschlands nach 2010 deutlich an, sondern auch das Risiko Italiens (Abbildung 2). Denn obwohl Italien seine Abhängigkeit von Erdöl seit 2010 etwas verringern konnte und den Anteil der erneuerbaren Energietechnologien am Primärenergiemix weiter ausgebaut hat (Tabelle 5), ist die italienische Volkswirtschaft in unvermindert hohem Maße von Erdgaseinfuhren abhängig.
Dabei stammen die Erdgasimporte vor allem aus Russland. Im Jahr 2020 betrug der Anteil des aus Russland bezogenen Erdgases rund 44 Prozent (29 Milliarden Kubikmeter, Tabelle A2 im Anhang). Während Italien damit nach Deutschland der zweitgrößte Importeur von russischem Erdgas in der Europäischen Union war, lag der Anteil von Erdgas am Primärenergiemix Italiens bei rund 40 Prozent, in Deutschland hingegen bei lediglich rund einem Viertel (Tabelle 4). Dementsprechend weist Italien ein ähnlich hohes gasspezifisches Risiko auf wie Deutschland (Abbildung A1 im Anhang). Einander ähnliche Verläufe weisen auch die öl- und kohlespezifischen Risiken von Italien und Deutschland auf (Abbildungen A2 und A3 im Anhang).
Die Energieversorgungsrisiken Japans und Frankreichs hatten Frondel, Ritter und Schmidt (2012) für das Jahr 1980 als noch deutlich höher taxiert als das für Deutschland. Japan und Frankreich gelang es in der Zwischenzeit jedoch, die Sicherheit ihrer Energieversorgung zu erhöhen und ihre damals sehr hohe Erdölabhängigkeit auf Anteile zu verringern, die in Japan heute unter 40 Prozent (Tabelle 6) und in Frankreich unter 30 Prozent liegen (Tabelle 7). Darüber hinaus setzt Frankreich unverändert auf die Kernkraft, die es in den achtziger Jahren massiv ausgebaut hatte; Kernkraft gilt in der energieökonomischen Literatur als quasi-heimischer Energieträger. Sie hat im französischen Primärenergiemix einen Anteil von rund 40 Prozent: Das ist unter allen G7-Staaten der bei weitem größte Anteil.
Japans Energieversorgungsrisiko ist nach den Ereignissen von Fukushima im Jahr 2011 vorübergehend wieder etwas gestiegen (Abbildung 2), da die Kernkraftwerke über viele Jahre ihren Betrieb einstellen mussten (IEA 2021). Heute spielt die Kernkraft nur noch eine untergeordnete Rolle für den japanischen Primärenergiemix (Tabelle 6). Stattdessen wurden die Anteile von Erdgas und Steinkohle ausgeweitet. Beide Energieträger müssen vom energierohstoffarmen Land Japan per Schiff importiert werden. Japan verbrauchte 2019 so viel verflüssigtes Erdgas (LNG) wie kein anderes Land, war der zweitgrößte Importeur von Kohle und der drittgrößte von Erdöl (IEA 2021, S. 24). Japan ist nach Luxemburg das Land mit dem zweitniedrigsten Selbstversorgungsgrad mit Energie unter den IEA-Ländern.
Der 5. Strategische Energieplan (SEP) Japans aus dem Jahr 2018 sieht für 2030 vor, dass der Anteil der Kernkraft am Primärenergiemix wieder auf 10–11 Prozent ausgeweitet wird. Hingegen wird davon ausgegangen, dass der Beitrag der Erneuerbaren lediglich moderat von rund 11 Prozent 2018 auf 13–14 Prozent 2030 steigt. Darüber hinaus soll der Anteil fossiler Brennstoffe am Primärenergiemix von 89 Prozent im Jahr 2018 auf 76 Prozent sinken, hauptsächlich durch eine Verringerung des Öl- und Gasverbrauchs (IEA 2021, S. 27).
Die beiden G7-Länder mit den geringsten Energieversorgungsrisiken sind Kanada und die Vereinigten Staaten (Abbildung 2). Diese Länder können auf sehr umfangreiche eigene Energieressourcen zurückgreifen. So gewinnt Kanada dank seiner Reserven an Erdöl und Erdgas weit mehr fossile Energierohstoffe, als es selbst benötigt: Kanada exportierte rund 44 Prozent seiner 2020 geförderten Energierohstoffe (IEA 2022h); im Primärenergiemix Kanadas machten Erdöl und Erdgas 2019 zusammen etwas mehr als 70 Prozent aus (Tabelle 8).
Auch die Vereinigten Staaten sind dank der „Schieferrevolution", die durch die Kombination aus der Horizontalbohrtechnologie und hydraulischem Fracking möglich wurde, mittlerweile praktisch zum Selbstversorger mit fossilen Energierohstoffen geworden (IEA 2019a, S. 20). Diese Technologien führten zu einem noch nie dagewesenen Anstieg in der Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen. Heutzutage sind die Vereinigten Staaten der weltgrößte Förderer von Erdöl und Erdgas. Beide Energieträger machen im Primärenergiemix nahezu 70 Prozent aus (Tabelle 9). Amerika spielt vor allem aufgrund der Erdgasexporte international eine führende Rolle in der globalen Energieversorgung (Frondel und Horvath 2019). In den siebziger Jahren war das Land hingegen noch sehr stark von Erdölimporten aus dem Nahen Osten abhängig.
Anders als in den Vereinigten Staaten nahm die Abhängigkeit des Vereinigten Königreichs von Importen fossiler Brennstoffe in den beiden vergangenen Dekaden deutlich zu und beträgt aktuell rund 40 Prozent (IEA 2019b, S. 24). Die Importabhängigkeit ist damit allerdings nach wie vor deutlich niedriger als die Importquote von Deutschland, die bei rund 70 Prozent liegt (Frondel 2022). Noch zu Beginn des Jahrtausends war das Vereinigte Königreich Selbstversorger mit Erdöl und Erdgas. Beide Energieträger machten im Jahr 2019 drei Viertel des Primärenergiemix aus (Tabelle 10). Trotz einer vorübergehenden Erhöhung der Öl- und Gasproduktion in den vergangenen Jahren und der sich daraus ergebenden Stabilisierung der Importquote ist langfristig zu erwarten, dass die Öl- und Gasvorkommen des Vereinigten Königreichs in der Nordsee zur Neige gehen werden.
Der dadurch drohenden Verschlechterung der Energieversorgungssicherheit begegnet das Vereinigte Königreich durch einen verstärkten Ausbau von Windparks vor den Küsten, während die Nutzung von Kohle beständig abnimmt; diese wird seit Jahren ausschließlich importiert. Steinkohle hatte 2019 lediglich noch einen Anteil am Primärenergiemix von unter 5 Prozent (Tabelle 10). Darüber hinaus sorgt die Diversifizierung im Gasangebot durch einen Mix aus heimischer Produktion, Pipeline-Importen sowie Importen von verflüssigtem Erdgas für eine vergleichsweise hohe Energiesicherheit (IEA 2019b, S. 24). Auch die Sicherheit der Versorgung mit Rohöl und Ölprodukten erscheint robust, obwohl das Vereinigte Königreich seit 2013 ein Nettoimporteur von raffinierten Ölprodukten ist (IEA 2019b, S. 24). Mit ein Grund für die verhältnismäßig sichere Versorgung ist, dass Ölvorräte vorgehalten werden, und zwar ausschließlich von der Industrie, die den Nettoimporten von rund 238 Tagen entsprechen. Die Internationale Energieagentur (IEA) verlangt von ihren Mitgliedsländern hingegen lediglich die Vorhaltung von Vorräten für mindestens 90 Tage.
Tabelle 8: Primärenergiemix Kanadas
1980 1990 2000 2010 2015 2019 Erdöl 46,1 % 36,9 % 33,6 % 37,0 % 37,2 % 32,4 % Erdgas 23,6 % 26,2 % 29,1 % 29,1 % 31,1 % 38,3 % Steinkohle 7,0 % 5,4 % 4,4 % 5,5 % 4,0 % 3,6 % Kernkraft 4,1 % 9,3 % 11,0 % 9,1 % 9,4 % 8,6 % Braunkohle 3,5 % 5,3 % 6,2 % 2,8 % 2,1 % 1,0 % Erneuerbare etc. 15,7 % 16,9 % 15,7 % 16,5 % 16,7 % 16,2 %
Quelle: Eigene Berechnungen der Anteile auf Basis von Daten aus IEA 2022g
Tabelle 9: Primärenergiemix der Vereinigten Staaten
1980 1990 2000 2010 2015 2019 Erdöl 44,4 % 40,0 % 38,7 % 36,4 % 36,1 % 36,0 % Erdgas 26,3 % 22,8 % 23,8 % 25,1 % 29,6 % 33,5 % Steinkohle 20,0 % 22,4 % 22,6 % 25,1 % 29,6 % 11,7 % Kernkraft 3,8 % 8,3 % 9,0 % 9,9 % 9,9 % 9,9 % Braunkohle 0,8 % 1,3 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % Erneuerbare etc. 3,4 % 5,2 % 4,9 % 5,9 % 6,9 % 8,1 %
Quelle: Eigene Berechnungen der Anteile auf Basis von Daten aus IEA 2022g
Tabelle 10: Primärenergiemix des Vereinigten Königreichs
1980 1990 2000 2010 2015 2019 Erdöl 40,8 % 38,9 % 36,2 % 31,4 % 33,0 % 35,8 % Erdgas 20,0 % 22,2 % 37,8 % 42,0 % 33,9 % 39,2 % Steinkohle 34,2 % 29,7 % 14,8 % 15,0 % 13,2 % 3,4 % Kernkraft 4,8 % 8,1 % 9,6 % 8,0 % 10,1 % 8,6 % Braunkohle 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Erneuerbare etc. 0,2 % 1,0 % 1,6 % 3,5 % 8,7 % 13,1 %
Quelle: Eigene Berechnungen der Anteile auf Basis von Daten aus IEA 2022g
Summa summarum zeigt sich wenig überraschend, dass das Versorgungsrisiko mit Energierohstoffen in jenen G7-Ländern am niedrigsten ist, die sich vollständig aus eigener Kraft mit Erdöl, Erdgas und Kohle versorgen können. Dies trifft traditionell auf Kanada, aber seit dem Fracking-Boom auch auf die Vereinigten Staaten zu. Umgekehrt ist tendenziell das Energieversorgungsrisiko in jenen Ländern mit am höchsten, die mangels ausreichender eigener Reserven den größten Teil an Energierohstoffen importieren müssen. Zu diesen energierohstoffarmen Ländern zählen insbesondere Japan, Italien und Frankreich. Allerdings gehen diese Länder unterschiedlich mit ihrem Mangel an eigenen Energierohstoffen um und weisen daher in Termini des Risikoindikators von Frondel und Schmidt (2009) ein deutlich unterschiedliches Energieversorgungsrisiko auf (Abbildung 2). So haben Frankreich und Japan ihre Energieversorgungssicherheit vor Jahrzehnten dadurch erhöht, dass sie stark auf den quasi-heimischen Energieträger Kernenergie gesetzt haben.
Italien hingegen hat den Einsatz der Kernkraft in den achtziger Jahren gänzlich aufgegeben und kann – im Gegensatz zu Deutschland – auch nicht auf heimische Braunkohlevorräte zurückgreifen. Stattdessen ist Italien stark abhängig von Erdgas und entsprechenden Importen. So wurde der Primärenergiebedarf Italiens in den vergangenen Jahren zu rund 40 Prozent durch Erdgas gedeckt (Tabelle 5); rund 40 Prozent des Erdgases wurden aus Russland importiert. Dies erklärt, warum Italien neben Deutschland unter den G7-Ländern das höchste Energieversorgungsrisiko aufweist. Die Hauptursachen dafür sind die fehlende Diversifikation der Energieträger im Primärenergiemix, aber vor allem die mangelnde Diversifikation der Lieferquellen bei den Importen fossiler Rohstoffe, insbesondere Erdgas. Dies hat sich nun auch für Deutschland als ein unkalkulierbares Klumpenrisiko herausgestellt.
Im Zuge des Krieges Russlands gegen die Ukraine ist Energieversorgungssicherheit wieder zu einem Thema von höchster öffentlicher und politischer Priorität geworden. Aus diesem Anlass haben wir die rohstoffspezifischen Risiken Deutschlands bei der Versorgung mit Erdöl, Steinkohle und Erdgas sowie das gesamte Energieversorgungsrisiko für Deutschland quantifiziert und dieses Risiko durch einen Vergleich mit dem der übrigen G7-Staaten eingeordnet. Dabei zeigt sich, dass das Risiko der Versorgung mit Energie dem von Frondel und Schmidt (2009) konzipierten Indikator zur Messung der langfristigen Energieversorgungssicherheit zufolge nicht nur seit dem Ende der siebziger Jahre immer weiter gestiegen ist. Dieser Anstieg hat sich vielmehr im Verlauf der vergangenen Dekade noch beschleunigt. Ursächlich geht der Anstieg vorwiegend auf die starke Zunahme der Rohöl-, Steinkohle- und Erdgasimporte aus Russland bei einem gleichzeitigen Rückgang der heimischen Anteile an der Versorgung mit diesen Energieträgern zurück.
Es liegt angesichts dieser Ergebnisse und unserer Analyse nahe, die Sicherheit der Versorgung mit Energie erstens durch eine Verbreiterung des Mix an Energierohstoffen und -technologien zu steigern, zweitens durch die Ausweitung der heimischen Gewinnung von Energierohstoffen und drittens dadurch, dass künftig eine stärkere Diversifizierung der Importe von Energierohstoffen aus einer Vielzahl an Bezugsländern angestrebt wird. Dies gilt in erster Linie für den fossilen Brennstoff Erdgas. Diesem war eine Brückenfunktion auf dem Weg zur Netto-Treibhausgasneutralität zugedacht, weil bei der Verbrennung von Gas vergleichsweise geringe Mengen an Emissionen anfallen und weil es nur wenige wirtschaftliche Alternativen bei den Stromspeichertechnologien gibt. Die intensive Nutzung von Erdgas als Brücke in eine treibhausgasneutrale Volkswirtschaft – festgeschrieben im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung – sollte neben der Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit auch einen gleitenden Übergang zu einer Wasserstoffwirtschaft begünstigen.
Um dieses Vorhaben fortzuführen, muss es gelingen, den massiven Import von Erdgas auf eine breitere Basis als bislang zu stellen. Gleichzeitig gilt es aber auch, die Errichtung einer Wasserstoffwirtschaft mit größerer Entschlossenheit als bislang zu verfolgen. Parallel zu den Bemühungen um eine stärker diversifizierte Lieferstruktur von Erdgas müssten vor allem die Bemühungen um den Aufbau einer Import- und Netz-Infrastruktur für die Wasserstoffwirtschaft verstärkt werden (acatech, Leopoldina und Akademienunion 2022).
Des Weiteren erscheint es sinnvoll, darüber nachzudenken, wie die Sicherheit der Energieversorgung durch den Einsatz eines breiteren Mix an Energierohstoffen und -technologien gesteigert werden könnte. In dieser Hinsicht wäre der alleinige Fokus auf einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren aufgrund des Rückgangs der Diversifizierung der Stromversorgung unzureichend, nicht zuletzt aber auch wegen der Volatilität der Erzeugung von Wind- und Solarstrom. Ebenso kritisch wäre ein ordnungsrechtliches Vorziehen des Kohleausstiegs in Deutschland auf das Jahr 2030 zu hinterfragen. Stattdessen gilt es anzuerkennen, dass mit dem „Kohleausstieg" angesichts der Koexistenz mit dem europäischen Emissionshandel keineswegs eine beschleunigte Defossilisierung des europäischen Energiesystems einhergeht: Die in Deutschland eingesparten Emissionen werden stattdessen woanders in Europa ausgestoßen, in Summe entstehen in der EU nur so viele Emissionen, wie die Obergrenze im EU-Emissionshandel gestattet.
Damit handelt es sich beim Ende der Kohleverstromung in Deutschland emissionstechnisch betrachtet lediglich um einen symbolischen Akt. Warum ein Ende der Kohleverstromung nicht eher den steigenden Preisen für Emissionszertifikate überlassen werden sollte, lässt sich daher nur schwer begründen. In der derzeitigen akuten Knappheitssituation ist es zudem hilfreich, dass reaktivierte sowie nicht wie geplant abgeschaltete Kohlekraftwerke die wegen der hohen Erdgaspreise ungleich teurere Stromerzeugung in Erdgaskraftwerken ersetzen und dadurch helfen, Erdgas einzusparen.
Hilfreich wäre schließlich auch eine unvoreingenommene Neubewertung der heimischen Gewinnung von Energierohstoffen, vor allem von Erdgas. Schließlich birgt der Import aus autokratisch geführten Staaten wie Katar das Risiko, die unerwünschte Abhängigkeit von Russland durch eine andere problematische Abhängigkeit zu ersetzen. Tatsächlich wurde Ende 2022 mit Katar ein Abkommen zur Lieferung von 2 Milliarden Kubikmetern LNG ab dem Jahr 2026 über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, wäre die Förderung von aus Schiefergestein gewinnbarem Erdgas in Deutschland durch den Einsatz hydraulischer Verfahren (Fracking). Nach einer Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe stellen die in Deutschland vorhandenen Ressourcen an Schiefergas etwa das Zehnfache des jährlichen Verbrauchs an Erdgas dar (BGR 2016: 13). Demnach lägen hier erhebliche Potenziale zur Verminderung der Abhängigkeit von importiertem Erdgas. Die Expertenkommission Fracking hat das Risiko, ein Erdbeben mit mehr als geringfügig schädigender Auswirkung durch Fracking zu induzieren, jüngst als äußerst gering eingeschätzt, die Gefahr für das Grundwasser als gering (Expertenkommission Fracking 2021, S. 24). Den Experten zufolge geht mit Fracking ein vertretbares Risiko einher, wenn derzeit geltende Standards eingehalten werden. Die Umsetzung dieser Möglichkeit in die Praxis würde zuallererst jedoch die Aufhebung des bestehenden Fracking-Verbots voraussetzen sowie den Aufbau entsprechender Förderstrukturen. Dennoch sollte zumindest geprüft werden, ob sich dadurch – anstatt große Mengen per Fracking gewonnenes verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) unter hohem Energieaufwand für Transport und Verflüssigung aus den Vereinigten Staaten zu importieren – nicht eine zugleich kostengünstige, weniger energieaufwendige und umweltverträglichere Möglichkeit eröffnen könnte, Erdgas in Deutschland zu gewinnen, um so zur heimischen Wertschöpfung und Versorgungssicherheit gleichermaßen beizutragen.
Die aktuelle Sorge um die Sicherheit der Versorgung mit Energie hat verdeutlicht, dass keines der drei Ziele des energiepolitischen Zieldreiecks, Wirtschaftlichkeit – Versorgungssicherheit – Umweltverträglichkeit, vernachlässigt werden darf. Daher wäre es wünschenswert, wenn dem Thema Versorgungssicherheit nicht nur vorübergehend deswegen eine große politische Relevanz beigemessen würde, weil ebenso wie im Winter 2022/2023 auch in den kommenden Wintern mit möglichen Engpässen in der Versorgung mit Erdgas zu rechnen ist. Die Gesellschaft steht vielmehr langfristig vor der Herausforderung, nicht nur Alternativen zur Kohle zu finden, sondern auch einen nachhaltigen Ersatz für Erdgas und Rohöl. Es wäre ratsam, dieser Herausforderung mit mehr Technologie- und Innovationsoffenheit zu begegnen, um die mittel- und langfristigen Klimaziele zu erreichen – trotz der vorübergehenden Notwendigkeit, aus Gründen der Versorgungssicherheit an fossilen Energieträgern festzuhalten.
Insbesondere sollte sich Deutschland offen gegenüber neuen Kernenergietechnologien zeigen. Dazu zählt nicht allein die Kernfusion, mit der zwar keine radioaktiven Abfallstoffe verbunden wären, aber deren erfolgreicher Durchbruch nach jahrzehntelanger Forschung mit vergleichsweise geringen Mitteln noch immer in den Sternen steht. Vielmehr zählen hierzu auch die sogenannten Kernreaktoren der vierten und fünften Generation, die aufgrund ihrer Konzeption inhärent sicher sind und die das immense, aber weitgehend ungelöste Problem der Beseitigung des in den vergangenen Jahrzehnten angehäuften Atommülls lindern könnten ([
Wünschenswert wäre auch die regelmäßige Erstellung von Berichten zur Einschätzung der Sicherheit der Energieversorgung und von langfristigen energiepolitischen Strategien zur Sicherung der Versorgung, so wie dies auch in anderen G7-Staaten wie Japan und Italien geschieht. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz berichtete zwar zuletzt in Fortschrittsberichten zur Energiesicherheit über die Fortschritte bei der kurzfristigen Verringerung der Importe an Kohle, Rohöl und Erdgas aus Russland (BMWK 2022). Mit Blick auf die langfristige Verbesserung der Energieversorgungssicherheit sollte sich die Erstellung von Berichten zur Energieversorgungssicherheit jedoch nicht allein auf Krisenzeiten beschränken.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Sicherheit der Energieversorgung keine rein nationale Angelegenheit ist. Sie muss in jedem Fall im europäischen Zusammenhang gesehen werden, wie die Verbundenheit der europäischen Staaten durch die Gaspipeline- und Stromnetzinfrastruktur klar vor Augen führt. Eine unkoordinierte Energiepolitik eines einzelnen EU-Mitgliedsstaates kann die Interessen anderer Mitgliedsstaaten beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund, wie auch aus ökonomischen und geostrategischen Gründen, ist es zwingend notwendig, auf EU-Ebene eine gemeinsame Energiepolitik zu entwickeln, nicht zuletzt um das erhebliche Gewicht Europas auf den globalen Energiemärkten durch gemeinsames Handeln wirkmächtiger nutzen zu können.
Wir danken Maira Kusch und Hans-Wilhelm Schiffer vom Weltenergierat Deutschland für wertvolle Anmerkungen sowie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für die finanzielle Unterstützung im Rahmen des Kopernikus-Projekts Ariadne.
Tabelle A1: Normierte Hermes-Indikatoren
Land Risiko Land Risiko Algerien 5/7 Nigeria 6/7 Arabische Emirate 2/7 Norwegen 0 Australien 0 Polen 0 China 2/7 Russland 4/7 Großbritannien 0 Saudi-Arabien 2/7 Irak 1 Südafrika 4/7 Iran 1 USA 0 Kolumbien 4/7 Venezuela 6/7 Libyen 1 Übrige 1 Niederlande 0
Quelle: Euler Hermes 2022
Tabelle A2: Anteile diverser Herkunftsländer an der Gasversorgung Italiens
Herkunft 1980 1990 2000 2010 2015 2019 Russland 23,9 % 29,3 % 28,4 % 17,9 % 40,6 % 44,1 % Algerien 0,0 % 22,1 % 38,0 % 33,0 % 11,2 % 17,6 % Katar 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 8,4 % 8,6 % Norwegen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 3,9 % 8,1 % Libyen 9,4 % 0,0 % 0,0 % 11,2 % 10,4 % 7,5 % Italien 46,6 % 36,2 % 22,5 % 10,0 % 10,0 % 6,3 % Niederlande 24,5 % 12,4 % 8,2 % 3,8 % 7,2 % 2,3 %
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten aus IEA 2022a, b
Graph: Abbildung A1: Erdgasspezifische Risiken in den G7-StaatenQuelle: Eigene Darstellung
Graph: Abbildung A2: Rohölspezifische Risiken in den G7-StaatenQuelle: Eigene Darstellung
Graph: Abbildung A3: Steinkohlespezifische Risiken in den G7-StaatenQuelle: Eigene Darstellung
By Manuel Frondel; Sven Hansteen; Marielena Krieg and Christoph M. Schmidt
Reported by Author; Author; Author; Author