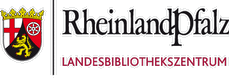Die Ukraine zwischen Russland und der Europäischen Union. Hrsg. von Gilbert H. Gornig und Alfred Eisfeld, Berlin: Duncker & Humblot 2021, 298 S. (= Abhandlungen des Göttinger Arbeitskreises e.V., 15), EUR 79,80 [ISBN 978-3-428-18497-2]
Die zehn Beiträge des vorliegenden Bandes sind in den Jahren 2019 bis 2021 geschrieben bzw. überarbeitet worden, sodass sie zwar vergleichsweise aktuell sind, aber den russländischen Eroberungskrieg gegen die Ukraine nicht mehr einbeziehen. Im Ganzen wird der Versuch gemacht, dem Leser einen Eindruck von der Entwicklung der Ukraine von den historischen Anfängen bis zur Gegenwart zu vermitteln und die Probleme, die Staat und Gesellschaft belasten, zu erläutern. Es sei vorweg bemerkt, dass, wenn eine bestimmte Sicht der Dinge dominiert, es die ukrainische ist. Wäre diese Bemerkung die einzige, die zu dem ersten Beitrag (Nataliya Popovytsch, Juriy Kopynets', Die Geschichte der Ukraine von der Antike bis zur Neuzeit) zu machen wäre, dann könnte man ihn einfach übergehen. Es ist nicht alles falsch, was da steht, aber was soll man davon halten, wenn im Zusammenhang mit der Herrschaftsbildung bei den Ostslawen die Normannen/Waräger mit keinem Wort erwähnt werden, wenn dementsprechend die Herkunft der Bezeichnung »Rus'« nicht, wie es der allgemeinen Forschungsmeinung entspricht, auf diese, sondern allein auf regionale Flussnamen zurückgeführt wird, oder wenn für die Zeit des 8./9. Jahrhunderts von einer frühen »Staatsunion im mittleren Dnipro[-]Gebiet« die Rede ist (S. 24). Weitere Beispiele, es gibt mehr als genug, ersparen wir uns hier. Das Ganze ist ausschließlich aus dem Internet zusammengesucht, es wird kein einziges wissenschaftliches Werk, auch keines aus der Feder eines ukrainischen Historikers, genannt. Wer sich für die Geschichte der Ukraine interessiert, sollte, statt seine Zeit zu vergeuden, beispielsweise zu dem Buch von Andreas Kappeler (Kleine Geschichte der Ukraine, 8., aktual. Aufl., München 2019) greifen. Die Herausgeber müssen sich jedoch fragen lassen, wie sie den Text ohne gründliche Überarbeitung in den Band aufnehmen konnten.
Einen Überblick über »Die Geschichte der Ukraine vom Beginn der Neuzeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs« gibt die Völkerrechtlerin Carolin Gornig, die sich im Wesentlichen an den Arbeiten von Kerstin Jobst und Andreas Kappeler orientiert, aber auch die sonstige einschlägige Literatur im Blick hat. Sie behandelt den Zeitraum von der Union von Lublin 1569, als Polen und Litauen sich definitiv zur vom Adel dominierten Doppelmonarchie zusammenfügten, bis zur Herausbildung einer unabhängigen ukrainischen Republik, die jedoch bald gewaltsam zur Sowjetrepublik umgeformt wurde. Bei aller Kürze ihrer Darstellung zeigt sie deutlich, dass sich das von Kosaken und Bauern getragene Selbstverständnis als Ukrainer gegen die Herrschaft der späteren Teilungsmächte nicht nur behauptete, sondern politisch weiterentwickelte. Dies ist gerade derzeit von großer Bedeutung, da maßgebliche russländische Politiker die Existenz der Ukraine in absurder Weise leugnen, sie zu vernichten suchen, das ukrainische Staatsgebiet aufteilen wollen und sich dabei auf die Teilungszeit Polen-Litauens berufen.
Seinen Beitrag über die Ukraine in der Zwischen- und Nachkriegszeit (1917–1991) hat der Kyïver Historiker und Politikberater Andrij Kudrjatschenko nüchtern und fakten- und datenbezogen angelegt. Dazu gehört beispielsweise eine Tabelle mit Angaben zu den verschiedenen staatlichen Gebilden auf ukrainischem Territorium am und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sowie zu den gewaltigen Opfern der Hungerkrise »Holodomor« Anfang der 1930er Jahre und der deutschen Besatzungsherrschaft während des Zweiten Weltkrieges. Was die Zugehörigkeit der Krym zur Ukraine betrifft, so erläutert Kudrjatschenko, dass es sich nicht um ein »Geschenk« Chruščëvs an die Ukrainische Sowjetrepublik gehandelt habe, vielmehr habe die geografische und strukturelle Nähe eine entscheidende Rolle gespielt. Einige Historiker verträten die Auffassung, Moskau habe damit die ethnische Zusammensetzung zugunsten des russischen Bevölkerungsanteils verändern wollen.
Viktor Kostiv, ein Finanzmanager, schildert seine Sicht auf die Ereignisse um den »Euromaidan«, an denen er in der westukrainischen Stadt Užhorod teilgenommen hat. Anschließend gibt er Einblicke in die Verhältnisse in den von Russland annektierten ostukrainischen Regionen, den »Volksrepubliken« Donezk und Luhansk. Seine historischen Rückverweise sind überflüssig, außerdem nicht seine Stärke, man hätte zumindest sie strenger redigieren müssen.
Die Merkmale und Symbole der ukrainischen Geschichtspolitik hat der Historiker Andreas Raffeiner zu seinem Thema gemacht. So erklärt er zum Beispiel den jeweiligen historischen Hintergrund der Motive auf den Geldscheinen. Dazu nur eine kurze Bemerkung: Mychajlo Hruševs'kyj als Osteuropahistoriker zu bezeichnen, ist ein wenig schief; er war der große Nationalhistoriker, der mit seinem Werk den Ukrainern eine prägende Idee ihrer historischen Identität vermittelte. Raffeiner blickt auf das »Große Staatswappen als modifizierte[n] Träger des ethnopopulistischen Geschichtsbildes«, auf die Fortführung der aus der Sowjetunion übernommenen traditionellen Formen, mit dem gerade für die Ukraine opferreichen Großen Vaterländischen Krieg und dem schwer errungenen Sieg umzugehen, auf die Bedeutung der Farbe Orange als Marke der demokratischen Opposition und auf vieles andere mehr. In den Schlussgedanken seines lesenswerten Beitrags deutet er den Versuch der orangefarbenen Revolutionäre, die zukunftweisende Wende zur Demokratie mit vertrauten Traditionen kreativ zu verbinden, als Neuerfindung der Nation, als Zeichen wachsenden Selbstbewusstseins auf dem Weg zu einer Zivilgesellschaft in einer sich herausbildenden Demokratie.
Dass die Ukraine noch eine lange Strecke zurückzulegen hat, um dem Ziel eines demokratischen Rechtsstaats näher zu kommen, ist auch der Grundgedanke des Historikers Alfred Eisfeld, der vor allem durch seine Arbeiten über die Deutschen in der Sowjetunion bekannt ist. In seinem faktenbasierten Aufsatz führt er vor Augen, mit welchem Wust an Problemen die demokratisch orientierten Kräfte zu kämpfen haben: Zusammenführung der ethnisch, kulturell, wirtschaftlich und politisch unterschiedlichen Regionen des Landes, Kampf gegen Korruption und Verrat bis in die höchsten Kreise, Erneuerung der weithin widerständigen bis konterkarierenden Justiz, dazu Abwehr und Ausgleich ausländischer Einflussnahme, Wahrung der von der Mehrheit der Bevölkerung getragenen Souveränität des Staates. Seit dem Beginn der russländischen Invasion am 24. Februar 2022 hat sich in Europa und der Welt vieles geändert, und die Probleme der Ukraine sind weder weniger noch geringer geworden.
Der protestantische Pastor Andreas Hamburg, gebürtig aus der Ukraine, wo er auch neun Jahre lang seelsorgerisch tätig war, stellt die Frage nach den Menschen. In zugegebenermaßen etwas holzschnittartiger Weise geht er von dem »homo sovieticus« aus, der historisch von der russischen Orthodoxie und einem absolutistischen Staat, einer Welt der Lügen und des Zwangs, kollektivistisch geprägt sei. Diesem obrigkeitshörigen, eher depressiven Menschen, der in seiner unbegrenzten Leidensfähigkeit nicht in der Lage sei, das System zu hinterfragen, stellt er den »homo oeconomicus« gegenüber, der zwar nicht besser, aber wenigstens »zurzeit noch mit der demokratischen Regierungsform kompatibel« (S. 200) sei. Der Seelsorger sieht seine missionarische Aufgabe darin, beide »Menschentypen« auf einen dritten Weg zu einem »homo divinus« zusammenzuführen. Was der Theologe allerdings außer Acht lässt, sind die seit Jahren allenthalben zunehmenden Veränderungen der Religionen und ihrer organisatorischen (kirchlichen) Strukturen.
Die letzten drei Beiträge stammen aus der Feder von Juristen und betreffen völkerrechtliche Aspekte des russländischen Vorgehens gegen die Ukraine. Wenn auch Teile der beschriebenen Sachverhalte inzwischen überholt sind, bleibt die grundsätzliche Feststellung gravierender Verstöße gegen das Völkerrecht doch unberührt. Holger Kremser behandelt die Annexion der Krym durch Russland und weist nach, dass die Übergabe der Krym 1954 entgegen allen Legenden auf einem formellen, der sowjetischen verfassungspolitischen Praxis entsprechenden Rechtsakt beruhte: Durch einen Gebietstausch der Oblast Rostov gegen die Krym wurden der Ukrainischen SSR von Moskau die immensen Kosten für den Volga–Don-Kanal auferlegt. Hinsichtlich der aggressiven Einmischung Russlands in die Ostukraine und der Ausrufung selbstständiger Volksrepubliken lassen sich völkerrechtlich, wie Carolin Gornig in ihrem zweiten Beitrag zeigt, Argumente wie Sezession oder Souveränität nicht halten, da es an den international definierten Voraussetzungen fehlt. Nach wie vor hält die russländische Führung daran fest, ihren Krieg gegen die Ukraine als militärische Spezialoperation zu deklarieren, um ihn so als internen Konflikt den internationalen kriegsrechtlichen Regeln zu entziehen. Auf die wirtschaftlichen Sanktionen, mit denen die Europäische Union die Beendigung der völkerrechtswidrigen russländischen Politik zu erzwingen versucht, geht Gilbert H. Gornig ein. Sie stimmen zwar, wie er darlegt, mit dem Völkerrecht überein, haben sich aber – bis Anfang 2022! – als wirkungslos erwiesen.
Ein in gewissen Teilen immer noch informativer Band.
By Hans Hecker
Reported by Author