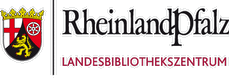Michael Beißwenger, Lothar Lemnitzer & Carolin Müller-Spitzer (Hg.). 2022. Forschen in der Linguistik. Eine Methodeneinführung für das Germanistik-Studium. Stuttgart: utb. 533 S.
Das zu besprechende Einführungsbuch hat gemäß dem Titel den Anspruch, Germanistikstudierende mit den Forschungsmethoden der Linguistik vertraut zu machen. Allgemeine linguistische Methodikeinführungen mit Praxisbezug sind nicht häufig und verlieren schnell an Aktualität, weshalb die Veröffentlichung bei Lehrenden und Lernenden der Linguistik prinzipiell willkommen sein dürfte. Optimalerweise können die Leser*innen erwarten, derart in die Forschungsmethoden eingeführt zu werden, dass eine Befähigung zum selbständigen Forschen erfolgt. Den Aufbau und Inhalt des Buchs daraufhin zu prüfen, ist die Kernaufgabe dieser Buchbesprechung.
Eine erste Auffälligkeit ergibt sich bei der Sichtung des Inhaltsverzeichnisses: Im Gegensatz zu den meisten Methodeneinführungen ist das vorliegende Buch als Sammelband und nicht als Monographie gestaltet. 33 Autor*innen haben Teil an der Inhaltsgestaltung. Typischerweise eignen sich Sammelbände jedoch nicht ideal dazu, einen bestimmten Themenbereich grundlegend und gänzlich abgebildet zu finden. Diese Publikationsart dient häufig eher dazu, ein bestimmtes Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, neuere Forschungsbeiträge zu einem Thema zu bündeln o.Ä. Dies schließt gelungene Zusammenfassungen eines Themas oder Fachbereichs zwar nicht aus; es erscheint schlicht sehr viel aufwändiger, durch Einzelbeiträge verschiedener Autor*innen einen Themenbereich als stringent abzudecken, auch weil die Verzahnung der einzelnen Beiträge deutlich schwieriger ist, als wenn der Inhalt aus einer oder wenigen Federn kommt.
Ein wesentliches Qualitätsmerkmal zeitgemäßer Fachliteratur – gerade wenn sie einer breiten Masse an Studierenden zur Verfügung stehen soll – ist die allgemeine und digitale Zugänglichkeit. Man kann darüber streiten, ob der Preis für ein Einführungsbuch mit ca. 50 Euro mit der Idee vereinbar ist, dass die Veröffentlichung allen Studierenden zur Verfügung steht. Von Angehörigen einer im Shibboleth-Authentifizierungssystem verzeichneten Institution lässt sich das Buch aber kostenfrei als PDF oder ePUB beziehen[
Das Buch enthält auf 533 Seiten 33 Kapitel, aufgeteilt auf acht inhaltliche Teile (1. Einführung und Grundlagen, 2. Fallstudien, 3. Daten – Metadaten – Annotationen, 4. Rechtliche und ethische Aspekte beim Umgang mit Sprachdaten, 5. Erhebung und Aufbereitung von Sprachdaten, 6. Korpusressourcen im Deutschen, 7. Werkzeuge für die empirische Sprachanalyse, 8. Anhang). Diese bilden drei Schwerpunkte: Auf 208 Seiten werden Fallstudien vorgestellt. Weitere 266 Seiten widmen sich den grundlegenden Aspekten korpuslinguistischer, sozialwissenschaftlicher und gesprächsanalytischer Methodologie, auch unter Berücksichtigung juristischer Aspekte bei der Erhebung und forschungsbezogenen Nutzung der Daten von Dritten. Zuletzt werden auf 104 Seiten Korpora und Analyseprogramme vorgestellt. Die Rezension kann nur einzelne interessante Aspekte herausgreifen, hierbei methodische Merkmale besonders berücksichtigen und Anwendungsempfehlungen für spezifische Leseziele formulieren. Das Kapitel 1 des Buchs (S. 11–20) bietet selbst eine vollständige Zusammenfassung des Buchinhalts.
Im Themenblock Fallstudien finden sich zehn Beiträge, die unter der Maßgabe verschriftlicht wurden, die methodischen Aspekte möglichst deutlich herauszuarbeiten. Inhaltlich handelt es sich um bereits durchgeführte und veröffentlichte Forschung. Die Leser*innen finden ein thematisch breites Spektrum an Projekten, die auch hinsichtlich methodischer Ausrichtung und Kompetenzvermittlung heterogen sind: Manche Beiträge vermitteln sehr anwendungsbezogen und können die Leser*innen direkt zu eigenem forschenden Handeln befähigen, weil einzelne Forschungsschritte unmittelbar reproduzierbar sind. Ein Paradebeispiel hierfür ist der erste Beitrag zur Verwendung des Ausdrucks Okay (und entsprechender Formvarianten) von Storrer & Herzberg (ab S. 37). Hierbei handelt es sich um eine korpuslinguistische Studie, die Lesende zu eigener Forschung inspirieren kann. Dies gelingt durch die folgenden Merkmale:
- – Die Forschungsziele werden gut motiviert. Diese sind im konkreten Fall eine Klassifikation der verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der polyfunktionalen Form Okay , ein Vergleich der Verwendungsanteile dieser Funktionen in einem medial mündlichen und einem medial schriftlichen Register und zuletzt ein sprachübergreifender Vergleich der Verwendung von Okay im Deutschen und Französischen.
- - Die methodischen Schritte zur Beantwortung der Forschungsfragen werden so detailliert beschrieben, dass sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch nachvollzogen werden können. Die in der Studie verwendeten Korpusressourcen – das FOLK-Korpus[
6 ] ([3 ] et al. 2023) sowie ein Wikipedia-Korpus (Margaretha & Lüngen 2014), das als Teil von DeReKo[7 ] am IDS Mannheim verfügbar ist – sind zugänglich, hinlänglich referenziert und Suchanfragen sowie das Vorgehen bei der Korpusrecherche sind gewissermaßen als Anleitung zum Selbermachen dargeboten. - – Die Erstellung der funktionalen Klassifikation des Worts Okay und der Umgang mit den Ergebnissen sind so kleinschrittig beschrieben, dass man als Einsteiger*in allem folgen und ggf. eigene Daten analysieren und äquivalente Ergebnisse erzeugen können sollte.
Ein weiterer Beitrag, der sich in diesem Sinn als praktische Anleitung und als Inspiration für eigenes empirisches Arbeiten verwenden lässt, ist Pia Bergmanns Studie zur Verwendung von keine Ahnung im mündlichen Sprachgebrauch (ab S. 82). Hier wird ähnlich wie im zuvor erwähnten Beitrag durch eine solide funktionale Klassifikation die Vielseitigkeit eines bestimmten sprachlichen Ausdrucks aufgezeigt.
Andere Projektvorstellungen besitzen zumeist wegen ihres Umfangs eine größere Abstraktheit und sind nicht gleichermaßen als Vorlage zu eigenen Studien geeignet. Ein Gegenpol zu den zwei vorgestellten Beiträgen stellt in diesem Sinne die Projektbeschreibung von Ziegler & Schmitz (ab S. 60) dar. Hier wird ein über mehrere Jahre finanziertes Kooperationsprojekt vorgestellt, das die Mehrsprachigkeit von Beschriftungen („Zeichen") im öffentlichen Raum der Metropole Ruhr untersucht und als Hauptanliegen prüft, inwieweit die Mehrsprachigkeit öffentlich sichtbarer Beschriftungen von dem Grad der Mehrsprachigkeit der Bevölkerung in diesem Raum abhängt und wie verschiedene Personengruppen im urbanen Raum zur Mehrsprachigkeit eingestellt sind. Die in dem Projekt getätigte Forschungsarbeit – ein Mix aus dem Aufbau einer riesigen topographischen, annotierten Bilddatenbank, ethnographischen Bevölkerungsdaten und via Befragungen abgebildeten Personeneinstellungen – ist interessant und anschaulich beschrieben. An diesem Beispiel ist die Notwendig-keit von mehreren ineinandergreifenden methodischen Zugängen gut nachvollziehbar. Der Beitrag veranschaulicht, warum bestimmte Forschungsinteressen größer angelegte Forschungsszenarien und langwieriger angelegte Projekte mit gesonderter Finanzierung erfordern.
Die drei genannten und die übrigen sieben Fallstudien sollen hier in einer tabellarischen Gesamtübersicht zusammengefasst und eingeordnet werden.
Tab. 1 Vergleich der im Buch vorgestellten Fallstudien nach festgelegten Kriterien.
Storrer & HerzbergS. 37–59 Verwendung von X X COSMAS II, Umgang mit Korpusbelegen Kap. 22; FOLK Kap. 25 Ziegler & Schmitz S. 60–81 Multilin-gualität im öffentlichen Raum X X Befragungen von Zeitzeug*innen Kap. 18; korpuslinguistische Weiterverarbeitung Kap. 23 und 27 zu GAT-Transkriptionen. BergmannS. 82–102 Phonetische Variation bei X FOLK Kap. 25; Transkriptionen, PRAAT Kap. 27; Frequenzver-gleiche, statistische Tests Kap. 21 und 28 Imo S. 103–121 Diskurs-marker (Kategorie und Typen) X X FOLK Kap. 25; andere Korpora eher schwer zugänglich und im Buch nicht besprochen. KämperS. 122–139 Emotion in Briefen von NS-Sympathisanten X Datengrundlage ist nicht referenziert bzw. nicht zugänglich. (?) Schwinning & MorekS. 140–161 Sprach-förderung durch Intervention X X Testdaten führen zu Gruppenvergleichen und statistischen Tests Kap. 21 und 28; Schülerdaten (Lernerkorpus) sind offensichtlich nicht verfügbar; im Buch wird die Lernerkorpusaufbereitung bis auf die Existenz mdl. Lernerdaten in Kap. 25 nicht thematisiert (vgl. z. B. Wolfer & Müller-Spitzer, S. 162–178 Sprach-förderung durch Lexika (X) X Verwendung eines Lernertexts aus einem Lernerkorpus, um selbigen von Studierenden korrigieren zu lassen. Studiendesign: Textrevisionstest für zwei Proband*innengruppen unter Bedingungen a) Verwendung von Online-Lexika als Hilfe sowie b) keine Hilfe. Kontrastive Auswertung Kap. 21 und 28. Beißwenger & Pappert, S. 179–200 Höflichkeit durch Emojis X X Beschrieben wird ein aufwändiges Testdesign (Planspiel) zur Erhebung der Verwendung von Emojis. Die Ergebnisse des Planspiels wurden als Korpus ausgewertet. Hansen, Bildhauer & Konop-ka, S. 201–224 Systematik variierender Verfugungen X Verwendung von DeReKo (Vorstellung: Kap. 24, Suche: Kap. 22) zur Extraktion einer Belegdatenbank für Wörter mit variabler Verfugung. Die weiterhin verwendeten automatischen und statistischen Verfahren werden im Buch nicht weiter vertieft (ggf. Kap. 21 und 28 zu deskriptiven und inferenziellen statistischen Verfahren). Brunner & JannidisS. 225–245 Redewiedergabe in verschiedenen schriftl. Texttypen X Gut nachvollziehbare Kategorisierung (Annotationen s. Kap. 14) von Redewiedergaben; Vergleich der Verwendung der verschiedenen Redewiedergabekategorien in den Texttypen Heftroman und Hochliteratur (s. Kap. 21 und 28 zu deskriptiven und inferenziellen Statistischen Verfahren).
Positiv hervorzuheben ist neben der fachlichen Ausrichtung innerhalb der Linguistik die Interdisziplinarität (siehe Themenwahl) vieler Studien – es gibt Übergänge zur Sozialwissenschaft (Ziegler & Schmitz), Geschichtswissenschaft (Kämper), Psychologie (Beißwenger & Pappert), Literaturwissenschaft (Brunner & Jannidis u. a.) und Didaktik (Schwinning & Morek, Wolfer & Müller-Spitzer). Die Übersicht zeigt außerdem, dass die meisten vorgestellten Forschungsprojekte (vorwiegend oder unter anderem) korpuslinguistisch agieren und der dominante Typ an Forschungsdaten schriftsprachliche Korpora sind. Befragungsdaten werden in zwei Fällen korpuslinguistisch weitergenutzt (siehe hierzu auch nachfolgende Anmerkungen zur Konzeption der weiteren methodischen Einführungskapitel).
Das Buch besteht, wie eingangs erwähnt, neben zwei Einführungskapiteln und den Fallstudien zweitens aus theoretisch-methodischen Einführungen zur Datenerzeugung, -auswertung und -interpretation sowie drittens aus der Vorstellung von Analyseressourcen. Das Voranstellen der Fallstudien ist für das Lesen des Buchs als Ganzes zunächst förderlich, weil die eigentliche Motivation für die Wahl bestimmter methodischer Verfahren offengelegt wird. Erwartbar ist, dass dabei nicht alle methodischen Details in den Fallbeispielen von den Lesenden nachvollzogen (geschweige denn selber umgesetzt) werden können, ohne weitere Informationen zum Datenmanagement, zur Ergebnisproduktion und -interpretation zu verarbeiten. Der interessante Ansatz des Buchs ist, diese Informationen in späteren Buchabschnitten nachzuliefern und durch konsequente Verweise zwischen den Kapiteln Vernetzungen herzustellen. Fraglich ist, ob durch eine prozessorientiertere Anordnung der methodischen Teile ein zugänglicherer Textfluss entstünde. Empirische Forschung startet bei der (
Die Aufgabe bei der Nutzung der vorliegenden Einführung besteht somit maßgeblich darin, Informationen, die für bestimmte Forschungsanliegen notwendigerweise zusammenkommen müssen, zu vereinen, ohne dass hierfür eine explizite Anweisung existiert. Einige potentielle Missverständnisse, die daraus erwachsen können, sollen im Folgenden ausgeräumt und einige Zusammenhänge zur Einordnung der Abschnitte konkretisiert werden:
- – Das Kapitel „Erhebung, Aufbereitung und Auswertung von Korpusdaten" (Abschnitt V) ist, weil es die o.g. Teilprozesse (
1 ), (2 ) und (3 ) vereint, gewissermaßen ein Querschnitt durch die Abschnitte III, V, VI und VII und somit stark redundant. Dies wird durch die Behandlung jeweils anderer Daten (hier wird das DWDS-System vorgestellt) ausgeglichen. - – Metadaten sind spezifische Annotationen (diese Kapitel stehen in Abschnitt III) und gehören zur Beschreibung der (
2 ) Datenaufbereitung (Abschnitt V). - – Korpora gesprochener Sprache (Abschnitt VI) werden heutzutage einer gesprächsanalytischen Transkription (Abschnitt V) unterzogen, enthalten Metadaten und meistens weitere Annotationen (Abschnitt III). Die gesprächsanalytische Transkription selbst ist das Resultat aus mehreren Annotationen, die in einem computergestützten Werkzeug (Abschnitt VII) realisiert werden. Beim Durchlesen des Buchs kann der Eindruck entstehen, es handelte sich jeweils um verschiedene Konzepte.
- – Die „Statistische Aufbereitung von Untersuchungsergebnissen" (Abschnitt V), das zugehörige Ressourcen-Pendant „Werkzeuge für die statistische Analyse" sowie Teile in „Werkzeuge für die Korpusanalyse" (Abschnitt VII) gehören zur (
3 ) Datenauswertung, der namentlich kein eigener Abschnitt gewidmet wird. Für verschiedene Funktionen im DWDS-, DTA-, COSMAS-II-, DGD- und ANNIS-Suchsystem, die häufig im Buch erwähnt werden, gilt dies gleichermaßen. Die meisten „erfolgreichen" korpuslinguistischen Plattformen und komplexen Annotationstools können also für die Datenaufbereitung und Datenauswertung (also für verschiedene Typen der Dateninterpretation) verwendet werden.
Diese Aspekte führen keineswegs dazu, dass die einzelnen Beiträge nicht gut lesbar wären, im Gegenteil: Jedes Kapitel hat einen hohen Wert für die Darstellung der empirischen Forschungslandschaft in der Linguistik. Einzig ein roter methodologischer Faden durchs gesamte Buch lässt sich nur durch diverse Hin- und Rückverbindungen zwischen Kapitelteilen spinnen.
Je nach Interesse bzw. Ziel können (neben der Verwendung des Sachregisters) folgende Empfehlungen zur Verwendung des Buchs hilfreich sein:
- – Falls Sie detaillierte Fragen zum Kernstück der Korpusrecherche – der Suche in komplex annotierten Korpora – haben, beginnen Sie mit Kap. 22 „Abfrage und Analyse von Korpusbelegen" (S. 374) und führen Sie die Beispielanfragen eigenhändig durch. Das Kapitel enthält sehr nützliche Querverweise zu weiteren Buchkapiteln.
- – Wollen Sie selber in die Annotation größerer schriftsprachlicher Datenmengen einsteigen, folgen Sie anschließend den Ausführungen zu WebLicht im Kap. 30 „Werkzeuge für die automatische Sprachanalyse". Machen Sie sich auch mit den Hinweisen zu den Verfahren in Kap. 13 „Daten und Metadaten", 14 „Linguistische Annotationen" sowie den Ressourcen in Kap. 24 „Korpora geschriebener Sprache" sowie 26 „Korpora internetbasierter Kommunikation" vertraut. Zur Annotation völlig individueller Phänomene sind INCEpTION, dem das Kap. 31 (S. 503) gewidmet ist, und EXMARaLDA eine gute Wahl.
- – Wollen Sie sich mit dem Umgang gesprochener Daten vertraut machen, können Sie zunächst die Hinweise zur Suche im FOLK-Korpus aus Kap. 3 „Alles okay!" befolgen, sich anschließend mit dem Konzept der „Gesprächsanalytische[n] Transkription" in Kap. 23 vertraut machen, nachfolgend die „Werkzeuge für die Transkription gesprochener Sprache" kennenlernen und sich zuletzt in Kap. 25 über Beispiele für „Korpora gesprochener Sprache" belesen.
- – Wollen Sie wissen, wie man Häufigkeiten bestimmter linguistischer Phänomene in Datenmengen abbildet und vergleicht, können Sie mit der Fallstudie in Kap. 5 „Sprachliche Variation im Gegenwartsdeutschen" beginnen und in den Kap. 21 „Statistische Aufbereitung von Untersuchungsergebnissen" sowie 28 „Werkzeuge für die statistische Analyse" die Auswertungen der Studie nachvollziehen. Beachten Sie dann die empfohlenen Hinweise zum Weiterlesen (S. 468–469).
- – Lesen Sie unabhängig vom konkreten Weiterbildungsziel das methodische Einführungskapitel 19 „Lautes Denken". Das Kapitel steht (scheinbar) etwas außerhalb, ist jedoch ein äußerst gelungenes Beispiel dafür, wie man eine empirische Methode theoretisch (hier anhand eines psycholinguistischen Modells) motivieren kann und das an sich sehr spezielle Verfahren wiederum mit den stärker kanonisierten Verfahren zusammenbringt.
Die Einschränkung auf die im Untertitel genannte Zielgruppe Germanistik-Studierender mag zum einen ihre Ursache in der Beschränkung auf deutschsprachige Daten haben oder auch in der oben erwähnten öffnenden Perspektive zu literaturwissenschaftlichen Kooperationen begründet sein. Viele methodische Aspekte gehen über dasjenige hinaus, was die angesprochenen Studierenden wissen und können müssen, um ihr Studium erfolgreich zu meistern. Diverse Beiträge im Buch scheinen umso relevanter für Promovierende und allgemein alle Forschende, die sich mit den im Buch dargestellten Aspekten vertraut machen wollen.
Der Titel mag, je nach Auslegung, suggerieren, die Einführung fasse möglichst umfangreich die sprachwissenschaftliche Forschungslandschaft zusammen. Hier werden viele Linguist*innen vermutlich widersprechen, weil ihre Forschung im Buch nicht abgebildet wird. Der Sammelband beschränkt sich zuallererst auf Forschungsansätze, bei denen empirische Daten Dritter erhoben werden. Bei grob einer Hälfte der im Buch behandelten Forschungsdaten handelt es sich um eigens für die linguistische Forschung elizitierte Daten (bspw. das Korpus FOLK). Die übrigen Fälle sind Beobachtungsdaten wie Internetdaten, Zeitungskorpora usw., die nach methodischen Vorgaben gesammelt und aufbereitet, aber nicht elizitiert wurden. Durch diese Einschränkung wird solche Forschung ignoriert, die mit weniger objektivierten Sprachdaten (bspw. mit introspektiven Grammatikalitäts- oder Akzeptabilitätsurteilen) operiert. Auch psycholinguistische und neurolinguistische Methoden bleiben weitestgehend unberücksichtigt. Dies ist an sich kein Problem und vielleicht die einzig praktikable Lösung für einen handhabbaren Buchumfang. Wünschenswert wäre lediglich, dass der gewählte Fokus des Buchs thematisiert bzw. explizit gemacht wird. Hierfür wäre ggf. eine einführende Klassifikation empirisch-methodischer Zugänge (vgl. z. B. [
Das rezensierte Buch ist ein äußerst nützlicher Sammelband für alle, die sich über den aktuellen Stand von empirischer Forschung informieren wollen, bei der evidenzbringende Daten korpuslinguistisch oder sozialwissenschaftlich erhoben, aufbereitet und ausgewertet werden. Der Aufbau führt die Leser*innen von interessanten exemplarischen Studien über methodische Überblicksartikel zu juristischen Grundfragen und Aspekten des Datenmanagements bis hin zur Vorstellung spezifischer technischer Werkzeuge. Vor allem durch die anschaulichen Fallstudien im ersten Buchteil, deren methodologische Schilderungen im weiteren Verlauf stärker vertieft und häufig mit konkreten Handlungsbeispielen versehen sind, kann das Buch Einsteiger*innen zu eigenen Forschungsansätzen befähigen. Damit hebt sich das Buch gegenüber vielen klassischen Methodeneinführungen positiv ab. Der Aufbau bzw. Ablauf und die Vernetztheit der Kapitel, die den Fallstudien folgen, hätte sich ggf. enger an großen methodologischen Blöcken im Studienverlauf orientieren und dafür auf die strikte Trennung von Konzepten und Ressourcen verzichten können. Je nach Interesse wird es sinnvoll sein, die Chronologie der Darstellungen zu durchbrechen und gezielt Artikel zu den verschiedenen Themenbereichen im Buch zu lesen (hierfür wurden Interessierten oben konkrete Vorschläge unterbreitet).
By Hagen Hirschmann
Reported by Author