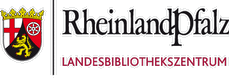Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der 2014 mit der Annexion der Krim-Halbinsel und dem Bürgerkrieg in der Ostukraine begann und seit dem 22. Februar 2022 vollumfänglich tobt, wird nicht nur aufgrund der geographischen Gegebenheiten und seiner Hauptkampflinien primär als Land- und Luftkrieg wahrgenommen. Auch bei der Debatte um die Unterstützung Kyjiws mit Waffenlieferungen dominiert, zumal im vom kontinentalen Denken durch und durch geprägten Berliner Politikbetrieb, eine landzentrierte Sichtweise. Es wird über Gefechtshelme, Flugabwehrraketen, Panzer und Marschflugkörper diskutiert – während in Schwarzmeer und Ostsee Entwicklungen von maritimem und strategischem Rang ablaufen.
Dieser Beitrag widmet sich zunächst den wesentlichen maritimen Aspekten des Krieges und skizziert deren Bedeutung für den Konfliktverlauf. In einem zweiten Teil werden die Ereignisse in Bezug zum russischen seestrategischen Denken gesetzt. Der dritte Abschnitt identifiziert Lehren, die die Deutsche Marine ziehen sollte.
Der üblicherweise gut informierte Analyst H I Sutton hat auf seiner einschlägigen Website die maritimen Aspekte des Ukraine-Kriegs seit Anfang 2022 zusammengetragen. Demnach war das Zusammenziehen von Truppen und Material schon vor Beginn der eigentlichen Invasion auch auf und von See zu beobachten. Zu nennen sind hier die Entsendung von Einheiten ins Mittelmeer – Russland hält dort seinen Stützpunkt im syrischen Tartus – sowie die Verlegung von frischen Kräften anderer russischer Flotten ins Schwarzmeer. Es handelte sich vor allem um amphibische Landungsschiffe und ein U-Boot der Kilo-Klasse, die vor Kriegsausbruch die türkischen Meerengen passierten. Auch Lkw-verlegbare kleine Angriffsboote vom Typ Raptor wurden von der Baltischen Flotte abgezogen und ins Krisengebiet gebracht – und dabei fotografiert.
Schon am 24. Februar 2022, dem Tag des Kriegsausbruchs, kommt es zu einer symbolischen Auseinandersetzung auf See. Der russische Kreuzer Moskwa, von dem noch die Rede sein wird, übermittelt einer kleinen ukrainischen Garnison auf der strategisch wichtigen, dem Donaudelta und dem rumänischen Staatsgebiet vorgelagerten Schlangeninsel den Befehl zur Kapitulation. Die Antwort der Verteidiger – im Wortlaut: „Russian warship, go fuck yourself!" – war für den weiteren Kriegsverlauf auf ukrainischer Seite sehr identitätsstiftend. Am selben Tag organisiert Russland eine De-facto Blockade des Schwarzmeeres für den Handelsverkehr. Es kommt zu ersten ernst zu nehmenden Störungen der Handelsschifffahrt. Die Türkei schließt am 28. Februar 2022 den Bosporus für Seestreitkräfte. Diese Maßnahme geschieht unter Bezug auf die Montreux-Konvention von 1936, die Ankara weitreichende Möglichkeiten zur Kontrolle des Seeverkehrs bietet und Schwarzmeer-Anrainern Gelegenheit zur Begrenzung von Kriegsschifftonnage im Seegebiet ermöglicht. Sie trifft alle Beteiligten, so etwa die sonst regelmäßig ins Schwarzmeer einfahrenden Einheiten der US-Marine, der britischen Royal Navy oder die Ständigen maritimen Einsatzverbände der NATO. Von besonderem Nachteil stellte sich die Montreux-Konvention aber für Russland dar, dem nun die Möglichkeit verwehrt war, weitere Schiffe ins Schwarze Meer zu verlegen. Nominell war die russische Marine weit überlegen, zumal Russland ab 2014 Vorkehrungen zur Unterminierung der verbliebenen ukrainischen Flotte unternommen hatte. Es war letztlich nur konsequent, dass die 1993 in Dienst gestellte Fregatte Hetman Sahaidachny (U130/F130), Flaggschiff der verbliebenen ukrainischen Seestreitkräfte, Anfang März 2022 neben anderen kleineren Booten selbstversenkt wurde, damit diese nicht vorrückenden russischen Verbänden in die Hände fallen würden.
Graph: Der russische Kreuzer Moskwa im Jahr 2012
In dem Maß, in dem der von Wladimir Putin als Enthauptungsschlag geplanter und als „Drei-Tage-Krieg" kommunizierter Vormarsch russischer Truppen ins Stocken geriet und dann zurückgeworfen wurde, fokussierte sich das öffentliche Interesse auf Orte und Geschehnisse an Land: Butscha, Saporischschja und natürlich auch Kyjiw und Odessa. Vor der ukrainischen Hafenstadt Odessa konzentrierten sich immer wieder amphibische Verbände, zu einer umgreifenden Landung konnte oder wollte sich das Marineoberkommando aber nicht entschließen. Ende März 2022 gelang der Ukraine ein erster Wirkungstreffer auf die Saratow, ein Landungsschiff der Alligator-Klasse. Vermutlich von einer Anti-Schiffsrakete getroffen, explodiert das Kriegsschiff im Hafen von Berdyansk. Zwei Ropuchas, Veteranen der Rotbanner-Flotte aus Sowjetzeiten, wurden beschädigt und liefen auf eigenem Kiel ab.
Am 13. April 2022 schließlich gelang es der Ukraine, den Kreuzer Moskwa mit Hilfe von Anti-Schiffsraketen vom Typ Neptun zu treffen. Das 11.500 Tonnen schwere, nach Russlands Hauptstadt benannte Flaggschiff war das mit Abstand größte Kriegsschiff im Schwarzen Meer. Es versank einen Tag später in den Fluten. Nachlässigkeiten bei der Verteidigungsfähigkeit des 1982 in Dienst gestellten Raketenkreuzers dürften ebenso beim Verlust mitgespielt haben wie mangelnde Leck- und Brandabwehr einer völlig unzureichend trainierten Besatzung. Vier Jahrzehnte nach dem Falklandkrieg, bislang einer der wesentlichen Datenpunkte für Marineanalysten weltweit, wird deutlicher denn je, welcher Gefährdung Hochwerteinheiten gegenüber Raketen ausgesetzt sind.
Derweil entwickelte sich die maritime Lage in einer Weise, die viele so nicht vorausgeahnt hatten. Am 27. Juli 2022 trat die Black Sea Grain Initiative in Kraft, die der türkische Präsident Recep Erdogan vermittelt hatte. In ihr einigten sich Russland und die Ukraine auf die Offenhaltung eines maritimen Korridors, der den sicheren Transit von Handelsschiffen zum Export von ukrainischem Getreide ermöglichen sollte. Bedingung war, dass Handelsschiffe mit Ziel Ukraine sich im Bosporus einer intensiven Kontrolle auf Waffenlieferungen unterziehen müssen. In Szenarien, die entfernt an den „Tanker-Krieg" 1987/88 im Persischen Golf erinnern, tasteten sich zivile Frachter durch treibminengefährdete Schifffahrtsstraßen gen Süden. Das sogenannte Getreideabkommen wurde in der Folge immer wieder in Frage gestellt und im Sommer 2023 von Russland aufgekündigt.
In der zweiten Jahreshälfte 2022 gelangen den ukrainischen Streitkräften weitere offensive Aktionen, darunter der erste Angriff auf das russische Marinehauptquartier in Sewastopol auf der besetzten Krim. Am 26. September 2022 erschütterten die Anschläge auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2, die allerseits im Kontext des Krieges an der europäischen Ostflanke verstanden werden, die Illusion von sicherer maritimer Energieinfrastruktur und manche stille Hoffnung in Berlin auf deutsch-russische Wiederannährung. Am 29. Oktober schließlich unternahm die Ukraine mit Überwasserdrohnen (uncrewed surface vessel, USV) Angriffe auf die russische Marine in Sewastopol. Bilder des Angriffs, so verpixelt sie auch waren, gingen um die Welt und signalisierten den Fortschritt im Bereich unbemannter maritimer Systeme. Russland zog in der Folge seine Schiffe in sicherere Positionen zurück, weil es mit weiteren Attacken und Verlusten rechnen musste. Auch sein Marinehauptquartier in Sewastopol ist seither immer wieder Ziel ukrainischer Angriffe, zuletzt mit erheblichem Verlust an Menschenleben im engeren Marineführungskreis der Russen.
In Kyjiws seestrategischem Verständnis ist auch die Brücke über die Kertsch-Straße, die Russland nach 2014 errichten ließ und die ab Ende 2022 Gegenstand von Sabotageversuchen wurde, ein ebenso legitimes wie sinnvolles Ziel. Im Oktober 2022 kam es zu einer ersten Sabotageaktion, die die Eisenbahnbrücke und die Straßenbrücke schwer beschädigte. Im August 2023 erfolge ein weiterer Angriff. Die Behinderung des Eisenbahn- und Straßenverkehrs nötigte die russische Marine, ihren zunehmend knappen Schiffsraum verstärkt für den Transport über das Asowsche Meer einzusetzen. Doch auch die dazu betriebenen Landungsschiffe blieben nicht vor Angriffen sicher. So wurde die RFS Olenegorsky Gornyak, die das Asowsche Meer zwischen der Krim und der Russischen Föderation überquerte, von einer Drohne getroffen. Auch ein in Ballast fahrender russischer Tanker wurde bei einem zweiten Angriff getroffen. Beide Schiffe wurden schwer beschädigt und fallen für den Seeverkehr auf unabsehbare Zeit aus.
Die strategischen Implikationen waren weitreichend. Die ukrainische Seekriegstaktik hat die russische Schwarzmeerflotte in die Defensive getrieben. So verlegte Russland einige seiner verbliebenen kampfkräftigen Einheiten aus dem Raum Sewastopol weiter nach Osten, um aus der Reichweite ukrainischer Marschflugkörper und Seedrohnen zu gelangen. Die Schließung der türkischen Meerengen belastet die russische Marinepräsenz zusätzlich, da beschädigte Fahrzeuge nicht aus dem Schwarzmeer herausgeführt werden dürfen und Verstärkung aus dem Mittelmeer nicht nordwärts gehen darf. Die zeitweise im östlichen Mittelmeer operierenden Kreuzer der Slawa-Klasse und ihre Begleitschiffe mussten im Lauf des bisherigen Konflikts wieder zur Nordflotte (mit Heimatstützpunkt im russischen Nordmeer) bzw. zur Pazifikflotte nach Wladiwostok zurückdampfen. Allerdings gelang es russischen Frachtschiffen wiederholt, mit als zivil deklarierter Ladung den Bosporus zu passieren.
Als Konsequenz dieser Entwicklungen hat sich Russland verstärkt auf drei Methoden der maritimen Kriegführung konzentriert:
- Seeminen: Schon seit Beginn der Eskalation im Frühjahr 2022 gab es mehrfach Sichtungen von Seeminen im Schwarzmeer, deren Herkunft man nicht immer bestimmen konnte, die jedoch für Aufregung sorgten. So wurde am 8. September 2022 der rumänische Minensucher Lieutenant Dimitrie Nicolescu von einer umgesetzten Treibmine beschädigt. Am 14. August 2023 trieb eine offenbar im Juli gelegte russische Seemine im rumänischen Costinesti an, die Explosion beschädigte eine Pier. Bukarests Seestreitkräfte haben seither ihre Minensuche verstärkt, allerdings zeichnet sich auch hier eine Fähigkeitslücke ab. Moderne MCM-Boote und Sensoren sind rar; der Stehende Minenabwehrverband der NATO (Standing NATO Mine-Countermeasures Group [SNMCMG] 2) operiert wegen der Sperrung des Bosporus für Kriegsschiffe nicht mehr im Schwarzen Meer. Auch im Dnjepr wurden russische Minensperren gesetzt, offenbar um ukrainische Flusskampfoperationen zu stören.
- Störung der Handelsschifffahrt und der Verladung in den Häfen: Russische Marschflugkörper und Drohnen haben nach Auskunft des britischen Außenministeriums (Stand 4. Oktober 2023) fast 300.000 t Weizen vernichtet. 130 Hafenanlagen (Lagerhäuser, Piers, Kräne, Zufahrten usw.) in Odessa, Chornomorsk und Reni wurden demnach zerstört. Nach der Aufkündigung des Getreideabkommens stoppten russische Kräfte medienwirksam einen unter der Flagge Palaus fahrenden Frachter, um ihn zu durchsuchen. Es deutete sich an, dass Russland verstärkt Seeminen einsetzen wird, was die Kosten-Nutzen-Kalkulation in der Region verändern würde.
- Landzielbeschuss: Russland greift Ziele auf dem Territorium der Ukraine durch Überwasserschiffe und U-Boote von See aus mit Marschflugkörpern an. Hinzu kommt der Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) gegen ukrainische Ziele. Die Bedrohung durch Russlands umfangreiche amphibische Fähigkeiten für die Küste rund um die ukrainische Hafenmetropole Odessa hat hingegen nach entscheidenden Wirkungstreffern und den notwendigen Absetzbewegungen der Flotte gen Osten an Bedeutung verloren.
Die Ukraine wiederum konzentriert ihre Bemühung in die folgenden Richtungen.
- Fokus auf kritische Infrastruktur: Die Rückeroberung der eingangs genannten Schlangeninsel im Juli 2022 war nicht nur in propagandistischer Hinsicht ein Erfolg, sondern bedeutete die Wiedererlangung einer zentral gelegenen Felsengruppe. Im Jahr 2023 fokussierte sich die Ukraine auf den Gewinn von kritischer Infrastruktur – die im August und September vorgenommenen Landungen auf den Öl- und Gasförderplattformen Boyko Towers seien in Erinnerung gerufen.
- Massiver Einsatz von Seedrohnen und Marschflugkörpern: Wie bereits erwähnt hat die Ukraine ihre Hauptseekriegsmittel weitgehend eingebüßt – und aus der Not offenbar eine Tugend gemacht. Das Zusammenwirken von Aufklärung, Ziel-Akquise und Schlag hat leicht überspitzt formuliert dazu geführt, dass Russlands Marine schwer getroffen wurde von einem Land, das keine richtige Marine mehr besitzt. Die Ukraine hat dabei die Schwächung der operativen Möglichkeiten der Russen ebenso im Blick wie die Symbolik. Die Versenkung des Kreuzers Moskwa ist hier zu nennen, ebenso sind es die grobkörnigen Videoclips als Part der Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Auch dass am 13. September, am 5. November und am 18. Dezember 2023 russische Kriegsschiffe in ihren Docks (ein weiterer zentraler Teil kritischer Infrastruktur) getroffen wurden, legt nahe, dass der ungleiche Kampf mit maritimen Methoden derzeit Vorteile für Kyjiw bietet.
Graph: Ukrainische Seedrohnen
Während viele – teilweise auch selbsternannte – Experten in Sachen Ukraine-Krieg versuchen, Rückschlüsse auf künftige Kriege unter Einsatz von Drohnen, elektronischer Kriegführung oder auch Informationskriegführung zu ziehen und dabei den „neuen" Wert von Kampfpanzern und Artillerie postulieren, hört und liest man sehr wenig über den Einsatz der russischen Marine. Darüber hinaus scheint sich der Fehler westlicher Experten zu Zeiten der Sowjetunion zu wiederholen, die russischen Marineeinheiten stets spiegelbildlich zu den westlichen Einheiten und deren Taktiken und Operationen zu betrachten. Ein gutes Beispiel für diese Sichtweise lieferte der frühere Marinestaatssekretär der USA, John Lehman, der in einem Buch die Überlegungen und Operationen der USA und der NATO in der Zeit des sowjetischen Admirals Gorschkow aufzeigte. Es sei schon in den 1980er-Jahren nicht um eine Schlacht im Atlantik gegangen, um den westlichen Nachschub aus den USA nach Europa zu unterbinden. Vielmehr wollte die Sowjetunion vorrangig großräumig ihre strategischen Unterseeboote schützen. Diese Aufgabe ist auch 2023 der russischen Marine im Nordmeer und Nordpazifik gestellt. Daran schließt sich die Frage an: Wo liegen die Gefährdungen für NATO und EU in ihren nassen Flankenräumen?
Will man sich dieser Fragen nähern, sollte man einen Blick auf den Epilog in Lehmans oben erwähntem Buch werfen. Nach Lehmans Erfahrungen lässt sich Abschreckung umgehend wiederherstellen mit einer neuen Strategie, die man allerdings umsetzen wollen muss. Dazu gehöre auch die bekannte militärische Erfahrung, dass man nicht nur Hochtechnologie bei neuen Plattformen, sondern mehr noch einsatzfähige Plattformen braucht. In Erinnerung an einen Ausspruch Churchills in einer Rede von 1935 schließt Lehman mit der Feststellung: „The choice we face is not between maintaining the balance of deterrence and following some other conceptual system, but between maintaining that balance and failing to do so." Auf 2023 und die Erfahrungen des Ukraine-Kriegs übertragen bedeutet dies: Man muss besonderes Augenmerk auf Russlands Fähigkeiten legen, mit modernen Marschflugkörpern und Hyperschallraketen gezielt kritische Infrastruktur in großen Entfernungen anzugreifen. Bislang sind weder die USA noch das Bündnis in der Lage, anfliegende Raketen und Marschflugkörper sowie deren Abschussplattformen mit Aussicht auf Erfolg zu bekämpfen. Für die NATO ist die entscheidende Frage: Wie soll man künftig umgehen mit russischen Einheiten der Nordflotte, Schwarzmeerflotte oder der Kaspischen Flottille, die auch in die Ostsee, Nordsee und ins Binnenland – nicht zuletzt auf Hafenanlagen, Rangierbahnhöfe und Autobahnknoten – einwirken können? Schon solch eine vermeintlich einfache wie drastische Überlegung deutet an, dass es nicht nur die Marine sein kann, die entsprechende Vorkehrungen treffen muss. Sie betrifft eine teilstreitkraftübergreifende, ja den Bereich der Gesamtverteidigung berührende Problematik.
Der bisherige Verlauf des Ukraine-Kriegs zeigt, dass die russischen Streitkräfte anders operieren, als NATO und EU angenommen haben. Das gilt auch für den maritimen Bereich. Stärker als bisher sind die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen zu berücksichtigen, die die heutige globale wie regionale Welt kennzeichnen. Der westliche Glaube an eine regelbasierte Ordnung ist stark erschüttert; der globale Süden unterstützt derzeit eher Staaten, die Russland, China und dem Iran auf deren Weg zu einer veränderten Weltordnung folgen wollen. Normen, auch Völkerrechtsnormen, werden bewusst missachtet oder gebrochen. Gerade das russische Militär fühlt sich in seiner Vorgehensweise nicht mehr an Recht und Völkerrecht gebunden und zielt in seinem Kampf auf Untergrabung des Verteidigungswillens der ukrainischen Bevölkerung. Sprechen russische und westliche Militärs hier noch die gleiche Sprache? Sollte man nicht genauer Grauzonen und deren mögliche militärische Nutzung ausleuchten?
Während des Kalten Krieges hatten insbesondere westliche Staaten die Sowjetunion und ihr Militär gern schwarz-weiß gesehen, entweder erschreckend stark oder kurz vor dem Zusammenbruch. Nur wenige machten sich die Mühe, mögliche unterschiedliche Interpretationen von Begrifflichkeiten zu analysieren und zu interpretieren. Eine der wenigen Ausnahmen stellte das 1989 erschienene Buch von Bryan Raft und Geoffrey Till dar. Es verwundert kaum, dass Tills Aufsatz „Russia: a sea power of a sort?" Aufnahme in einen 2023 publizierten Sammelband zum Thema russische Maritime Strategie fand. Till zeichnet die Veränderungen der russischen Marine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach und veranschaulicht den Bedeutungsaufwuchs der Nordflotte auch an den Veränderungen in der Arktis und der zunehmenden Nutzung der Nordwestpassage für Handelsschiffe. Die geographischen Gegebenheiten dieser riesigen Region ließen Konzepte von Seemacht entstehen, die nicht mit denen von Großbritannien, Japan oder den USA vergleichbar seien. Russland sei eher regional als auf die Weltmeere ausgerichtet, wolle sich eher vor Angriffen von See her schützen. Dies ändere jedoch nichts an der Aufgabe seiner Flotten, russische Streitkräfte auch von See aus in ihren Bewegungen an Land zu unterstützen und zu schützen. Dafür hätten sie inzwischen moderne Fregatten und Korvetten entwickelt, die alle mit den gleichen weitreichenden Waffensystemen ausgerüstet seien. Die russische Marine habe von den Modernisierungsanstrengungen unter Putin stärker profitiert als die Landstreitkräfte. Allerdings hätten nicht alle Flotten zu gleichen Teilen Ausrüstung, Ausbildung und Schlagkraft verbessern können, sondern litten in Teilen noch heute unter den bis 2010 anhaltenden drastischen Sparmaßnahmen.
Folgt man den Überlegungen von Till, so sieht sich die heutige russische Marine als Unterstützer von Russlands Rolle als eurasische Macht. Sie will in Eurasien ihren Einfluss stärken und in einem zunehmend maritimen Umfeld international bestehen. Moskau nutzt seine Marine für Versorgung von überseeischen Interessensgebieten (z. B. Syrien), für lokale bzw. regionale Verteidigung und für strategische Abschreckung. Im Kriegsfall fällt der russischen Marine der Schlag tief gegen gegnerische Bereiche zu. Auch Operationen im hybriden Grauzonenbereich sind fest eingeplant. Im Verein mit ihren atomaren Optionen ist sie für westliche Marinen nicht zu unterschätzen. Aufgrund der Erfahrungen mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und anderen unbemannten Systemen im Schwarzen Meer sehen sich auch NATO-Marinen gezwungen, ihre Operationsplanungen an neuartige Bedrohungen anzupassen. Zu diesen gehören die Unterbrechung von Unterwasserkabeln und Versorgungsleitungen (Öl und Gas) bereits in Krisenzeiten sowie Bedrohungen von kritischen westlichen Infrastrukturen wie Öl- und Windkraftfelder auf See oder Hafenanlagen für die Anlandung von Nachschub und Versorgung in den europäischen Atlantik- und Nordseehäfen. Das heißt im Umkehrschluss: Eine verlässliche Abwehr von Kalibr-Marschflugkörpern sollte bereits bei Ausbruch eines Konflikts mit Russland eine primäre Aufgabe westlicher Streitkräfte sein. Aber auch zivile Organisationen werden sich darauf einstellen müssen.
Da die russische Marine Teil der Militärstrategie ist, die der russische Generalstab erarbeitet und verkündet, finden sich in ihr auch nicht typisch westliche Konzepte wie area denial oder anti-access wieder. Westliche Operationskonzepte zur Abwehr der russischen Seestreitkräfte sollten daher auf ihre Schlüssigkeit überprüft und – so notwendig – angepasst werden. Dies ist nicht zuletzt wichtig, weil die Modernisierung mit weitreichenden Flugkörpern qualitativ und quantitativ eine Herausforderung für westliche Marinen darstellt. Andererseits bleibt die Fähigkeit der U-Boot-Jagd russischer Einheiten deutlich hinter westlichen Möglichkeiten (mittels neuer Technologien) zurück. Daher kann Russland den Schutz seiner strategischen U-Boote (SSBN) in Barentssee und Arktis nicht in dem Maß sichern, wie die Bedrohung der nuklearen Zweitschlagsfähigkeit es verlangen würde. Die drastische Reduzierung von Marinefliegereinheiten hat dieses Problem erheblich verschärft.
Neben dem Fazit, dass Moskau selbst bei eingeschränkten Mitteln sehr risikobereit ist, ergeben sich für die Ostsee und deren Anrainer einige Optionen, die sich hier nur kurz anreißen lassen. Diese resultieren aus den neu gewonnenen Erkenntnissen über Drohneneinsätze in einem Seekrieg, die im Ukraine-Krieg die Schwarzmeerflotte unter erheblichen Druck gesetzt haben. Eine große Anzahl billiger Kamikaze-Drohnen dürften in naher Zukunft zum Bestand der russischen Flotte gehören. Solche Drohnen könnten den Mangel an russischen Marinefliegerkräften in Küstennähe mehr als ausgleichen, zumal man sie von Schiffen der Flotte, aber auch von Handelsschiffen, Fähren, Fischereifahrzeugen und ähnlichen Plattformen aus einsetzen kann.
Weg von Großkampfschiffen und hin zu kleineren Einheiten in Fregatten- und Korvettengröße mit gleicher weitreichender Raketen- und Cruise-Missile-Bewaffnung – diese Entscheidung Russlands ermöglichte den Bau neuer, kostengünstigerer Plattformen, die sich in größerer Stückzahl beschaffen lassen. Die Containerisierung der Flugkörper eröffnet die Option, diese nicht nur von Kriegsschiffen oder Küstenbatterien, sondern auch von Handelsschiffen aus einsetzen zu können. Auf diese Weise ließe sich auch in der Ostsee und ihren Zugängen eine 360-Grad-Bedrohung aufbauen.
Weiterhin dürfte die russische Marine aus dem Debakel ihres schlecht gegen Luftangriffe verteidigten Stützpunkts Sewastopol gelernt haben und aufgrund dieser Erfahrungen zügig den Schutz ihrer Anlagen in der Ostsee verbessern. Da die dort beheimateten Schiffe und Boote mit ihren weitreichenden Raketen die Häfen aller Anrainer der Ostsee und auch von Teilen der Nordsee bedrohen können, müssen NATO und EU geeignete Maßnahmen ergreifen.
Trotz aller finanziellen Einschnitte konnte die russische Marine die technologische Weiterentwicklung ihrer U-Boote fortsetzen. Die strategischen U-Boote der Borei-Klasse befinden sich in der Einführung, je sechs sollen später der Nordflotte und der Pazifikflotte zugeordnet werden. Zusätzlich lief der Marine ein erstes U-Boot der Belgorod-Klasse zu, das als Hauptbewaffnung ein großes unbemanntes Fahrzeug mit Nuklearantrieb (Poseidon) trägt, das sowohl nukleare wie konventionelle Systeme über große Reichweiten einsetzen kann. Zwei weitere U-Boote dieser Klasse sind im Bau und werden bis 2027 in der Flotte erwartet.
Im Bereich der Mehrzweck-U-Boote werden fünf SSN der Akula–Klasse derzeit modernisiert und sollen 2025 wieder der Flotte zulaufen. Die Modernisierung umfasst nahezu alle Systeme wie Antrieb, Bewaffnung, Hydroakustik, Elektronik und Navigation. Der wichtigste Teil scheint die Ausstattung mit universellen Abschussrohren zu werden, aus denen Kalibr- und Oniks-Marschflugkörper verschossen werden können. Auch Tsirkon-Raketen soll man nach ihrem Zulauf aus diesen Rohren verschießen können.
Mit gewisser Verzögerung laufen die neuen, nuklearangetriebenen Mehrzweck-U-Boote der Yasen–Klasse der Flotte zu, die sowohl eigene SSBN in den jeweiligen Einsatzräumen schützen als auch gegnerische Trägerverbände bekämpfen sollen. Sie sollen die bisherigen SSN verschiedener Klassen ersetzen und so Unterhaltungs- und Logistikkosten einsparen. Technologisch sehr beeindruckend, stößt diese Klasse allerdings wegen hoher Bau- und Betriebskosten an die Grenzen des Machbaren in Russland.
Bei den U-Booten mit konventionellem Antrieb blieb die neu entwickelte Lada-Klasse stark hinter den Erwartungen zurück. Dies führte zur Wiederaufnahme des Baus der dritten Generation von U-Booten der Kilo-Klasse mit Wasserjet-Antrieb. Hauptbewaffnung sind acht Kalibr-Marschflugkörper für Seezielbekämpfung oder Landzielbeschuss. Diese U-Boote eignen sich sowohl für den Schutz der eigenen Küsten als auch für die weiträumige Bekämpfung von kritischer Infrastruktur und gegnerischen Flotteneinheiten.
Bei den Überwassereinheiten scheinen die von Präsident Putin propagierten Flugzeugträger, Kreuzer und großen Zerstörer bis heute nicht über Entwürfe hinauszukommen, so dass man berechtigt fragen kann, ob die russische Marine künftig nur noch aus kleineren Schiffs- und Bootseinheiten sowie aus Landungsfahrzeugen für begrenzte Landungsoperationen bestehen wird. Die bisher bekannten Neubau- und Modernisierungspläne lassen den Schluss zu, dass die Überwasserausstattung der russischen Marine nur für Küstenverteidigung und Abschreckung geeignet sein dürfte. Die eigentliche Stärke verbleibt somit bei der U-Boot-Flotte mit ihren SSBN, SSN und konventionell angetriebenen U-Booten. Mit diesen Kräften lässt sich durchaus eine glaubwürdige Bedrohung europäischer Marinen, Küsten und Häfen, von Ölförderanlagen auf See und seegestützten Windenergieparks aufbauen und erhalten. Der frühere Commander der US Naval Forces Europe, Admiral Foggo, hat das wie folgt auf den Punkt gebracht: Die russische Marine habe gezeigt, dass sie alle europäischen Hauptstädte aus jedem europäischen Gewässer heraus bekämpfen kann. Dieses Konzept ist auch unter dem Begriff „Flotte gegen Küste" bekannt geworden.
Werden russische Mehrzweck-U-Boote wie in der Vergangenheit vorrangig zum Schutz eigener SSBN eingesetzt, bleiben nur wenige für andere maritime Aufgaben übrig. Auch daraus kann man schließen, dass westliche Vorstellungen von einer neuen Schlacht im Atlantik nicht den russischen Vorstellungen und operativen Plänen entsprechen.
Auch wenn die Zahl russischer Marineflugzeuge massiv reduziert wurde, sind die Möglichkeiten der russischen Langstreckenaufklärer und Bomber nicht zu unterschätzen. Ihre luftgestützten Marschflugkörper und Hyperschallflugkörper sind in westlichen Überlegungen zu berücksichtigen. Russische Strategie und operative Planungen, gepaart mit der oben angesprochenen Risikobereitschaft, können erhebliche Verluste auch im regionalen Kontext der Ostsee und angrenzender Gebiete bewirken.
Die obigen Ausführungen legen einige Empfehlungen nahe. Für keine davon brauchte es den Russland-Ukraine-Krieg und die Performanz der russischen Seestreitkräfte, denn seit vielen Jahren schon diskutiert die sicherheitspolitische und strategiewissenschaftliche Community of Interest diese Themen. Die globale Polykrise droht, in der nur noch gehandelt wird und langfristige Aspekte unberücksichtigt bleiben.
Zum einen bedarf es dringend eines Denkens in neuen Szenarien – mit neuen Technologien. Statt, wie leider immer noch die Regel, in Beschaffungszeiträumen von 15 Jahren und mehr zu denken, braucht es Rahmenbedingen und Köpfe, die Entwicklungen schneller umsetzen können. Es braucht den allfälligen Bürokratieabbau, dazu klarere Leitlinien der Politik, die in weniger statt mehr Prüfaufträgen münden. Nationale und multinationale Forschung in Wissenschaft und Technik muss forciert werden. Man muss Räume schaffen für kreatives, innovatives und disruptives Denken, das diese Zuschreibung auch verdient, und Abstand nehmen von maßgeschneiderten, risikoaversen Goldrandlösungen.
Die Stärkung der Resilienz von Bevölkerung, Wirtschaft, Militär und Politik – im europäischen Rahmen, aber mit klarer nationaler Komponente – bleibt eine Herkulesaufgabe. Doch nur so lässt sich die Dialektik von Landes- und Bündnisverteidigung mit Leben füllen. Zu all diesen potenziell schmerzlichen Veränderungen gehört auch die Umstrukturierung der Wirtschaft, um, wenn politisch erfordert, den schnellen Aufwuchs einer Kriegsproduktion zu ermöglichen.
Auch braucht es eine optimale Vereinheitlichung von Maßen und Kalibern, um eine europaweite gemeinsame Produktion von Waffen und Munition zu ermöglichen. Das heißt auch: zurück zu einer logistischen Bevorratung von 7 und 30 Tagen. Diese Erkenntnisse sind nicht neu, aber unbequeme Wahrheiten werden anscheinend nicht gern gehört.
Mit Blick auf die maritime Domäne braucht es gesetzgeberische Maßnahmen, um die Seeblindheit zu reduzieren und die Streitkräfte bündnisweit zu befähigen, Sicherheit und Abschreckung auf See weiterhin zu gewährleisten. Es gibt viel Handlungsspielraum – vom Seesicherheitsgesetz über eine schlagkräftige Küstenwache bis hin zur Vollausstattung der Deutschen Marine, so wie sie in strategischen Dokumenten des Atlantischen Bündnisses gefordert wird.
By Sebastian Bruns and Heinz-Dieter Jopp
Reported by Author; Author
Leitender Wissenschaftler der Abt. Maritime Strategie und Sicherheit
Kapitän zur See a. D.