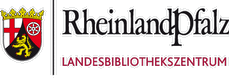Konnte man den Krieg Russlands gegen die Ukraine vorhersehen?
Der Überfall Russlands auf die Ukraine kam für die meisten Politikerinnen und Politiker in Deutschland völlig überraschend; selbst der Bundesnachrichtendienst soll es für unwahrscheinlich gehalten haben, dass Russland tatsächlich angreift. Gilt dasselbe für die Wissenschaft? Nein: Zumindest in Teilen der anwendungsorientierten Sozialwissenschaften (Osteuropaforschung, strategische Wissenschaft) warnte man seit Jahren vor dieser Möglichkeit, insbesondere nachdem Russland 2014 die Krim annektierte und in Teilgebieten der Ukraine „Bürgerkriege" angeblich unterdrückter Russen vom Zaun brach. Hingewiesen wurde dabei vor allem auf folgende Fakten und Entwicklungen:
- Den zunehmend autoritären, kleptokratischen und kriminellen Charakter der putinschen Machtvertikale, die sich in großem Umfang selbst bereichert und im Umgang mit Feinden und Abtrünnigen gern zu Mitteln greift, die man sonst nur von der organisierten Kriminalität kennt, so etwa Täuschung, Erpressung, Kaufen von Politikern und Mordanschläge. Derartige Strukturen tendieren dazu, ihre internen Legitimitätsprobleme zu externalisieren, indem sie nationalistische und imperialistische Narrative entwickeln und konsequent anwenden.
- Die Übernahme und Instrumentalisierung großrussisch-imperialistischer und faschistischer Narrative in der Politik Putins. Er hatte damit Erfolg, weil diese Narrative an in der Gesellschaft vorherrschende Stimmungen anschlossen. Auch eignet sich Kriegsmobilisierung als Instrument der Herrschaftssicherung.
- Die zunehmende anti-westliche Rhetorik und Politik von Putins Denken und Handeln. Sie ließ erkennen, dass Russland schon zu Beginn dieses Jahrhunderts eine Revision der zwischen 1990 und 1997 zusammen mit der Sowjetführung und Russland ausgehandelten europäischen Sicherheitsordnung anstrebte und die strategische Konfrontation mit dem Westen suchte, die als langandauernd und weitgehend eingestuft wurde.
- Die Nutzung von Militär als Instrument zur Ausweiterung des Machtbereichs der russischen Führung und die konsequente Aufrüstung und Modernisierung der russischen Streitkräfte seit etwa 15 Jahren. Modernisierung und Aufrüstung zeigten spätestens ab 2013 an, dass Russland regionale Konflikte als Austragungsorte einer gegen die USA und die NATO gerichteten Politik sah. Ähnliches galt für die Aufrüstung Russlands mit nuklearwaffenfähigen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, die sich gegen Europa wandte und das Ende des INF-Vertrags einläutete. Auch darauf wurde in der wissenschaftlichen Literatur hingewiesen.
- Russlands zunehmende politische Nutzung des Erpressungspotenzials seines Militärapparats zur Einschüchterung der westlichen Staaten. Damit einhergehend wurde der Übergang zu einer politischen und informationellen Kriegführung gegen den Westen festgestellt. Ziel war die Destabilisierung westlicher Gesellschaften, ihrer politischen und Wirtschaftssysteme.
- Das Bestreiten der Existenz der Ukraine und die andauernde Nutzung militärischer und nicht-militärischer Instrumente zur Destabilisierung und Zerstörung der Ukraine als selbstständiger Nation. Aus diesem Grund warnten Wissenschaftler wiederholt vor einer großen Invasion der Ukraine.
- Den Umbau des Systems der aus Russland nach Europa verlaufenden Erdgaspipelines. Damit sollte die Ukraine umgangen (Nord Stream 1 und 2, Turkstream) und geschwächt werden, eine Voraussetzung für die Annexion der Krim im Jahr 2014.
- Die zunehmende Gefährdung der baltischen Staaten sowie des weiteren Ostseeraums durch provokante militärische Manöver oder hybride Kriegsführung seitens Russlands.
Zudem wurde auf Defizite deutscher Russland- und Energiepolitik hingewiesen. Diese Hinweise legen nahe: Will die Politik in Deutschland sich künftig besser vor Überraschungen schützen, dann sollte sie die Ressource Wissenschaft besser nutzen. Allerdings ist der anwendungsorientierte Charakter der Sozialwissenschaften nicht allein ausschlaggebend. Sieht man sich die Analysen der ebenfalls anwendungsorientierten deutschen Friedensforschung an, so muss man feststellen, dass sie in den vergangenen 25 Jahren mit Blick auf Russland genau jene falschen Schlüsse, Empfehlungen und Schlagworte generierte, die die Bundesregierung in ihrer fehlgeleiteten Politik bestätigt haben. Deutsche Friedensforscher und Friedensforscherinnen lieferten geradezu den ideologischen Überbau für Deutschlands von Illusionen und Selbsttäuschungen geprägte Russlandpolitik. Als Russland 2014 die Krim annektierte und mithilfe von Spezialtruppen und nationalistischen Freischärlern im ukrainischen Donbas einen „Bürgerkrieg" inszenierte, da sprach das (jährlich erscheinende) „Friedensgutachten" der fünf wichtigsten Institute der Friedensforschung nicht von einer russischen Annexion oder davon, dass Russland Grenzen revidieren wolle. Unerwähnt blieb auch die russische Politik der Hochrüstung oder dass Moskau den Westen strategisch herausfordere. Vielmehr diagnostizierte man das Wiederaufkommen von „traditionellen Großmachtkonflikten" und kritisierte, westliche Rüstungsanstrengungen hätten diesen „Großmachtkonflikt" angeheizt. Zudem wurde ausgiebig nach Fehlern des Westens geforscht, die Russland zu diesen völlig unverständlichen Schritten verleitet hätten. Auch behaupteten Friedensforschern bar jeglicher Kenntnis vor Ort, dass die Bevölkerung der Krim mehrheitlich den Anschluss an Russland befürworte.
Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter des größten Friedensforschungsinstituts, der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), veröffentlichten 2017 einen Aufsatz, in dem sie den westlichen Staaten die Schuld an Moskaus Ukraine-Politik zuschrieben. Die 1990 von den westlichen Staaten und der Sowjetführung unterzeichnete Charta von Paris – das „Grundgesetz" der internationalen Ordnung in Europa – sei ein Missverständnis gewesen. Russland habe sich in berechtigter Weise aus der liberalen Ordnung des Westens befreit und sei befugt zu verhindern, dass sich die Erweiterung der NATO fortsetze. Vertreter der Osteuropawissenschaft kritisierten dies seinerzeit zu Recht als Freibrief für die Wiederherstellung einer russischen Vorherrschaft im postsowjetischen Raum. Im Bereich der strategischen Wissenschaften erkannte man mit ziemlicher Klarheit, dass Putin einen Weg der Revision von Grenzen beschritten hatte und seine 2011 begonnene Politik der Hochrüstung nichts Gutes verhieß. Nicht allen Friedensforscher und Friedensforscherinnen kann man diese fatale Fehleinschätzung vorwerfen, aber es war die vorherrschende Meinung in diesem Wissenschaftsbereich. Umso wichtiger ist es, solchen Wissenschaften zu vertrauen, die sich nicht von ideologischen Prämissen leiten lassen, sondern – im Geist des Wissenschaftsansatzes von Karl Popper – nur Befunde veröffentlichen, die einer kritischen Überprüfung standhalten.
Die zentralen ideologischen Prämissen der Friedensforschung in Deutschland fußten erstens auf der prinzipiellen Ablehnung von Abschreckungspolitik und dem Militär als Instrument der Politik generell. Der zweiten Grundannahme zufolge würden Konflikte auf Missverständnissen und Misstrauen beruhen und müssten durch gutes Zureden und Vertrauensbildung beigelegt werden. Ein ganz wesentliches Anliegen war und ist es, „Rüstungswettläufe" zu verhindern, abzubauen oder zu beendigen. Rüstungskontrolle solle dazu dienen, Missverständnisse über Rüstungsvorhaben anderer Staaten auszuräumen. In dieser Vorstellungswelt gibt es keine Feinde mehr. Dafür gibt es Gegner, nämlich all jene in der westlichen Welt, die mit diesem Denken nicht konform gehen – und meistens in den USA zu finden sind. Es ist im Prinzip nicht falsch, es zunächst mit gegenseitigem Vertrauen und Gesprächen zu versuchen, um Konflikte zu lösen – das ist der Standard der amerikanischen und westeuropäischen Diplomatie seit über 100 Jahren. Auch kann Rüstungskontrolle ein wichtiges Instrument der Diplomatie sein. Aber zu leugnen, dass es Staaten gibt, die uns feindlich gesonnen sind, bedeutet, dass man aus Konfliktbearbeitung eine Art Ideologie werden lässt. Und Wissenschaft und Ideologie sollten sich eigentlich ausschließen.
Vertreter der auf realistischer Basis operierenden anwendungsorientierten Sozialwissenschaften lagen zwar auch nicht immer richtig, doch das Befassen mit anwendungsorientierter Wissenschaft hilft bei der Vorausschau und vor allem, eigene politische Vorgaben kritisch in Frage zu stellen. In Deutschland ist die Ressource Wissenschaft zwar vorhanden, im Vergleich zur angelsächsischen Welt jedoch deutlich unterentwickelt und vor allem unausgeschöpft. Durch die maßgebliche Orientierung deutscher Universitäten und der Forschungsförderung des Bundes an sozialwissenschaftlicher Grundlagenforschung und infolge der dominanten Position der Friedensforschung spielen anwendungsorientierte Formen der Sozialwissenschaft wie Strategieforschung und Osteuropakunde (insbesondere Russlandforschung) immer noch eine untergeordnete Rolle. Hier zeichnet sich in Forschungsförderung und Wissenschaftspolitik leider noch keine Zeitenwende ab.
[
Literatur
1
Adomeit, Hannes (2016): The Putin System: Crime and Corruption as Constituent Elements, Europe-Asia Studies, 68 (6), 1067–1073
2
Adomeit, Hannes (2017): Innenpolitische Determinanten der Putinschen Außenpolitik, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 1, (1), 33–52
3
Adomeit, Hannes (2020): Russlands subversive Kriegsführung in der Ukraine, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 4 (2), 195–206
4
Adomeit, Hannes (2021): Russland und der Westen: Von „strategischer Partnerschaft" zur strategischen Gegnerschaft, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 5 (2), 107–124
5
Adomeit, Hannes (2022): Russisch-belarussisches Manöver Sapad-2021: Teil der Kriegsvorbereitungen gegen die Ukraine, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 6 (1), 68–73
6
Allison, Roy (2014): Russian ‚deniable' intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules Get access Arrow, International Affairs, 90 (6), 1255–1297
7
Andersson, Jan Joel/Balsyte, Erika (2016): Winter is coming. Chilly winds across northern Europe. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS)
8
Åslund, Anders (2018): Die ökonomischen Kosten der fortbestehenden russischen Aggression gegen die Ukraine, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 2 (4), 352–365
9
Åslund, Anders (2019): Russia's Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy. New Haven: Yale University Press
Åslund, Anders/Kuchins, Andrew (2006): The Russia Balance Sheet. Washington, D.C.: The Peterson Institute for International Economics/The Center for Strategic and International Studies
Baev, Pavel (2020): Transformation of Russian Strategic Culture. Impacts From Local Wars and Global Confrontation. Paris: Institut français des relations internationales (Ifri)
Belton, Catherine (2021): Putin's People. How the KGB took back Russia and then took on the West. Glasgow: William Collins
Brauß, Heinrich/Krause, Joachim (2019: Was will Russland mit den vielen Mittelstreckenwaffen? Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 3 (2), 154–166
Connolly, Richard/Boulègue, Mathieu (2018): Russia's New State Armament Programme. Implications for the Russian Armed Forces and Military Capabilities to 2027. London: Royal Institute for International Affairs
Council of Foreign Relations (2006): Russia's Wrong Direction: What the United States Can and Should Do. New York: Council of Foreign Relations
Dawisha, Karen (2014): Putin's Kleptocracy. Who Owns Russia? New York: Simon & Schuster
Dembinski, Matthias/Spanger, Hans-Joachim (2017): Pluraler Frieden. Leitgedanken für eine neue Russlandpolitik, Osteuropa, 67 (3–4), 87–96
Dick, Charles (2019): Russian Ground Forces Posture Towards the West. London: Royal Institute of International Affairs
Forss, Stefan/Kiianlinna, Lauri/Inkinen, Pertti/Hult, Heikki (2013): The Development of Russian Military Policy and Finland. Tampere: National Defence University, Research Reports No 49
Galeotti, Mark (2016): Heavy Metal Diplomacy: Russia's Political Use of its Military in Europe since 2014. Brüssel/London: European Council on Foreign Relations
Giles, Keir (2016): Russia's ‚New' Tools for Confronting the West: Continuity and Innovation in Moscow's Exercise of Power. London: Royal Institute for International Affairs (RIIA)
Goldman, Marshall I. (2008): Petrostate. Putin, Power, and the New Russia. Oxford; Oxford University Press
Gressel, Gustav (2021): Russia's military movements. What they could mean for Ukraine, Europe, and NATO. Berlin: European Council for Foreign Relations (ECFR), Comment
Hackett, James (2021): Die Modernisierung der russischen Streitkräfte, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 5 (2), 125–139
Heinemann-Grüder, Andreas (2015): Lehren aus dem Ukraine-Konflikt. Das Stockholm-Syndrom der Putin-Versteher, Osteuropa, 65 (4), 3–23
Heinemann-Grüder, Andreas (2022): Russlandpolitik in der Ära Merkel, Sirius – Zeitschrift für strategische Analysen, 6 (4), 359–372
Hill, Fiona/Gaddy, Clifford G. (2015): Mr. Putin: Operative in the Kremlin. Washington, D.C.: Brookings Institution
International Crisis Group (2018): Patriotic Mobilisation in Russia. Brüssel: ICG
Johnson, Dave (2019): General Gerasimov über die Entwicklungslinien der russischen Militärstrategie – Eine Analyse, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 3 (3), 255–261
Jonsson, Oscar/Seely, Robert (2015): Russian Full-Spectrum Conflict: An Appraisal After Ukraine, The Journal of Slavic Military Studies, 28 (1), 1–22
Kristensen, Hans M. (2018): Russland modernisiert Kernwaffendepot im Bezirk Kaliningrad, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 2 (4), 398–400
Kroenig, Matthew (2018): Russlands Nuklearstrategie gegenüber Europa – wie organisiert man Abschreckung gegen Deeskalation mit nuklearen Schlägen?, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 2 (4), 323–338
Larrabee, F. Stephen (2010): Russia, Ukraine, and Central Europa. The Return of Geopolitics, Journal of International Affairs, 63 (2), 33–52
Lavrov, Anton (2018): Russian Military Reforms from Georgia to Syria. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Mommsen, Margareta (2017): Das Putin-Syndikat. Russland im Griff der Geheimdienstler. München, C. H. Beck
Monaghan, Andrew (2016): Russian State Mobilization: Moving the Country on to a War Footing. London: Royal Institute of International Affairs
Muzyka, Konrad (2020): Russian Forces in the Western Military District. Washington, DC: Center for Naval Analysis (CAN)
Nilsen, Thomas (2018): Russland erweitert im großem Umfang seine Kernwaffenlager auf der Kola-Halbinsel, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 2 (4), 401–405
Omelicheva, Mariya Y. (2021): Repression Trap. The Mechanism of Escalating State Violence in Russia. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Polyakova, Alina/Laruelle, Marlene/Meister, Stefan/Barnett, Neil (2016): The Kremlin's Trojan Horses. Washington. D.C.: The Atlantic Council 2016
Raik, Kristi (2020): Sicherheitspolitische Dilemmata der baltischen Staaten, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 4 (2), 190–191
Raik, Kristi/Aaltola, Mika/Kallio, Jyrki/Pynnöniemi, Katri (2018): The Security Strategies of the US, China, Russia and the EU. Living in Different Worlds. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs
Roberts, Brad (2020): Neue Herausforderungen erfordern neue Ideen: Elemente einer Theorie des Sieges in modernen strategischen Konflikten, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 4 (4), 410–434
Robinson, Linda/Helmus, Todd C./Cohen, Raphael S./Nader, Alireza/Radin, Andrew/Magnuson, Madeline/Migacheva, Katya (2018): Modern Political Warfare. Current Practices and Possible Responses. St. Monica: RAND Corporation
Sokolsky, Richard (2017): The New Nato-Russia Military Balance: Implications for European Security. Washington, D.C.: The Carnegie Endowment 2017
Treverton, Gregory F./Thvedt, Andrew/Chen, Alicia/Lee, Kathy/McCue, Madeline (2018): Addressing Hybrid Threats. Stockholm: Swedish Defence University und Center for Asymmetric Threat Studies
Umland, Andreas (2009): Pathological Tendencies in Russian „Neo-Eurasianism": The Significance of the Rise of Aleksandr Dugin for the Interpretation of Public Life in Contemporary Russia, Russian Politics & Law, 47 (1), 76–89
Umland, Andreas (2013): Berlin, Kiew, Moskau und die Röhre: Die deutsche Ostpolitik im Spannungsfeld der russisch-ukrainischen Beziehungen, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 6 (3), 413–428
Umland, Andreas (2020): Die friedenspolitische Ambivalenz deutscher Pipelinedeals mit Moskau – eine interdependenztheoretische Erklärung des russisch-ukrainischen Konfliktes, Sirius – Zeitschrift für Strategische Analysen, 4 (3), 293–303
Voronin, Yuriy A. (1997): The Emerging Criminal State: Economic and Political Aspects of Organized Crime in Russia, in: Williams, Phil (Hrsg.): Organized Crime in Russia: The New Threat. London; Frank Cass, 53–62
Wehner, Markus (2016): Putins Kalter Krieg. Wie Russland den Westen vor sich hertreibt. München: Knaur
Werkner, Ines-Jacqueline, Hrsg. (2014): Friedensgutachten 2014 der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST), dem Institut für Entwicklung und Frieden (INEF), dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH), der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) und dem Bonn International Center for Conversion (BICC). Münster: LIT-Verlag
Westerlund, Fredrik (2021): The role of the military in Putin's foreign policy. An overview of current research. Stockholm: Swedish Defence Research Agency (FOI)
Zdanavičius, Liudas/Czekaj, Matthew, Hrsg. (2015): Russia's Zapad 2013 Military Exercise. Lessons for Baltic Regional Security. Washington, D.C. und Riga: Jamestown Foundation und National Defence Academy of Latvia
Zwack, Peter B./Pierre, Marie-Charlotte (2018): Russian Challenges from Now into the Next Generation: A Geostrategic Primer. Washington, D.C. Institute for National Strategic Studies der National Defense University
]
[
Footnotes
[50] 1997,[22] 2008,[16] 2014,[1] 2016,[35] 2017, Aslund 2019,[12] 2021.
Aslund/Kuchins 2006, 101 ff.,[47] 2009,[11] 2020,[39] 2021, International Crisis Group 2018.
Council of Foreign Relations 2006,[33] 2010, Hill/Gaddy 2015,[51] 2016,[2] 2017,[4] 2021, Jonsson/Seely 2015, Zwack/Pierre 2018, Raik/Aaltola/Kallio/Pynnöniemi 2018.
[36] 2016,[45] 2017, Connolly/Boulègue 2018,[34] 2018,[29] 2019,[18] 2019,[37] 2020,[24] 2021,[53] 2021.
[43] 2020.
[32] 2018,[38] 2018, Brauss/Krause 2019.
[20] 2016,[21] 2016, Polyakova/Laruelle/Meister/Barnett 2016, Treverton/Thvedt/Chen/Lee/McCue 2018, Robinson/Helmus/Cohen/Nader/Radin/Magnuson/Migacheva 2018.
[48] 2013,[6] 2014,[25] 2015,[8] 2018.
[23] 2021,[3] 2020,[5] 2022.
[49] 2020.
Forss/Kiianlinna/Inkinen/Hult 2013, Zdanavičius/Czekaj 2015,[41] 2020, Andersson/Balsyte 2016.
Siehe auch den Aufruf von 2014 „Friedenssicherung statt Expansionsbelohnung", Aufruf von über 100 deutschsprachigen OsteuropaexpertInnen zu einer realitätsbasierten statt illusionsgeleiteten Russlandpolitik, Academia.Edu,https://www.academia.edu/9852777/Friedenssicherung%5fstatt%5fExpansionsbelohnung%5fAufruf%5fvon%5f%C3%BCber%5f100%5fdeutschsprachigen%5fOsteuropaexpertInnen%5fzu%5feiner%5frealit%C3 %A4tsbasierten_statt_illusionsgeleiteten_Russlandpolitik.
Stellungnahme der Herausgeber und Herausgeberinnen: Aktuelle Entwicklungen und Empfehlungen, in:[52] 2014, 1–30.
Werkner 2014, 5.
Dembinski/Spanger 2017.
Siehe hierzu[26] 2022, 357 f.
Taras Kuzio: How Western Experts Got the Ukraine War So Wrong,geopoliticalmonitor.com, 13.10.2022.
]
By Joachim Krause
Reported by Author
Geschäftsführender Herausgeber der Zeitschrift SIRIUS, Direktor emeritus, Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel